BOSSA-SH
Bodenschätzungs-Standard-Auswertung
Schleswig-Holstein
Übersetzung
und Auswertung der Profilbeschreibungen der
Bodenschätzung
als Grundlage für die Bodenbewertung in der
Landschaftsplanung
Dr. E.-W. Reiche
fachliche Beratung:K.
Kühl
Entwickelt im
Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten
des Landes
Schleswig-Holstein
BOSSA-SH
Eine Methode zur Bodenbewertung
in der Landschaftsplanung
Im Zeitraum von 1934 bis 1950
wurde unter dem Titel "Reichsbodenschätzung" eine
flächendeckende bodenkundliche Aufnahme der landwirtschaftlich-
und gartenwirtschaftlich genutzten Böden vorgenommen. In mehr
oder weniger regelmäßigen Zeitabständen werden die gewonnenen
Informationen im Rahmen von Nachschätzungen aktualisiert.
Gemessen an der Informationsdichte und dem Grad der
Flächendeckung stellt dieses Datenmaterial eine für das Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland einmalige bodenkundliche
Wissensbasis dar. In der Vergangenheit dienten die
unterschiedlichen Informationsebenen der Bodenschätzung in
erster Linie der Bewertung der Ertragsfähigkeit von Böden für
steuerliche Belange sowie Flurbereinigungen. Die Nachfrage nach
standortbezogenem bodenkundlichen Wissen von Seiten der
Raumplanung ist in den letzten Jahren erheblich angewachsen. In
Anbetracht einer für die Zukunft zu fordernden stärker
ökologisch orientierten Ausrichtung jeglicher Planung ist auf
diesem Gebiet mit einer unter den heutigen Verhältnissen der
Datenaufbereitung und -bereitstellung kaum zu bewältigenden
Informationsbedarf zu rechnen.
Ein wesentliches Anliegen bei der
Entwicklung des Programmes "BOSSA-SH" war es, ein
sowohl in Bezug auf die erforderliche Hardware-Ausstattung, als
auch in Hinsicht auf die Bedienungsfreundlichkeit einfach
anzuwendendes Programmpaket herzustellen, welches stufenweise,
wie der Experte, die Übersetzung der Bodenschätzungsdaten in
die Fachsprache der wissenschaftlichen Bodenkunde vornimmt und
darüber hinaus einige wichtige bodenphysikalische Eigenschaften
ableitet. Das Programm ist auf allen handelsüblichen
WINDOWS-PC's (WINDOWS 3.1, WINDOWS 95, WINDOWS NT) einsetzbar und
verwendet das Datenbanksystem DBase. Im Gegensatz zu anderen
digitalen Auswertungsansätzen wurde hier ein besonderer Wert auf
eine die in den Schätzungsunterlagen vorliegenden Infomationen
nicht vorinterpretierende Datenübernahme gelegt. D.h., daß die
in den Feldschätzungsbüchern niedergeschriebenen Zeichenfolgen
unverändert in die Variablenfelder der Datenbank zu übertragen
sind. Eine Vorauswertung hat den entscheidenden Nachteil, daß
Informationen durch die auf heute vorhandenes Wissen basierenden
Interpretationsregeln verändert werden. Ergeben sich in der
Zukunft Variationen in der Auswertungs- und
Interpretationsmethodik, so müßte die äußerst aufwendige
Dateneingabe wiederholt werden. Dieser Aspekt hat insbesondere
deshalb erhebliches Gewicht, weil davon auszugehen ist, daß eine
präzise Auswertung jeweilige regionale Besonderheiten mit
einzubeziehen hat. Die hierfür erforderlichen Detailkenntnisse
können aber erst im Laufe der Arbeit mit der Bodenschätzung und
ihrer digitalen Auswertung gewonnen werden; so daß sehr
wahrscheinlich mit einer Präzisierung der Übersetzungsregeln in
Zukunft zu rechnen ist.
Das vorliegende Programm ist
keineswegs als ein in seiner Entwicklung abgeschlossenes, nicht
mehr veränderbares Instrument anzusehen. Gerade weil auch die
einzelnen Teilergebnisse der Übersetzungs- und
Auswertungsroutinen in Datenfeldern abgelegt werden, kann ohne
Schwierigkeiten die Plausibilität der Auswertung überprüft
werden. Da es sich um ein konsequent modular aufgebautes
Programmpaket handelt, ist die Optimierung bzw. Korrektur
einzelner Übersetzungs- und Auswertungsmodule ohne größere
Schwierigkeiten möglich. Es soll ausdrücklich dazu ermutigt
werden, Kritik und Verbesserungsvorschläge anzubringen. Aufgrund
der modularen Struktur ist es z.B. denkbar, in Zukunft für
einzelne Übersetzungsschritte durch einfache
Verzweigungsalgorithmen die Auswahl spezifischer Unterprogramme
von der Zuordnung zu einzelnen Naturräumen abhängig zu machen.
Was leistet das Programm
BOSSA-SH?
Das Programm ist konzipiert als
bodenbezogenes Auswertungs- und Bewertungswerkzeug und soll
speziell den Anforderungen der Landschaftsplanung genügen. Im
wesentlichen werden 4 Funktionsbereiche abgedeckt:
- Bereitstellung einer Eingabemaske zur
Digitalisierung der profilbezogenen Bodenschätzungsdaten
und Überprüfung ;
- Übersetzung der Profilbeschreibungen
(Grablochbeschreibungen) der Bodenschätzung in die
Sprache der wissenschaftlichen Bodenkunde;
- Ableitung von physikalischen und
physikochemischen Kenngrößen;
- Durchführung einer funktionsbezogenen
Bewertung des Bodenprofils.
Die Ergebnisausgabe des Programmes
Bossa-SH beschränkt sich bewußt auf die aus Sicht des Planers
relevanten Kenngrößen und Bewertungsergebnisse.
Welche Voraussetzungen sind
für den Einsatz von BOSSA-SH zu erfüllen?
Auf der Hardware -Seite ist ein
handelsüblicher PC (IBM-kompatibel, vorzugsweise
Pentium-Prozessor) mit mindestens 16 MBArbeitsspeicher und
mindestens 5 MB freiem Festplattenspeicher vorauszusetzen. Das
Programm wird von WINDOWS Versionen 3.1, Windows 95 oder
Windows-NT unterstützt. Darüber hinaus liegen keine besonderen
Soft- und Hardware Anforderungen vor. Die Eingabe- und
Ergebnisdaten werden standardmäßig im DBF-Format gehalten. Eine
Exportmöglichkeit in das ASCII-Format wird angeboten.
Datenanforderungen
Das Programm BOSSA-SH verarbeitet
die Grablochbeschreibungen der Bodenschätzung. Hierbei handelt
es sich um profilbezogene Angaben zur Bodenart, Bodenfeuchte,
Bodenfarbe und anderen Charakteristika. Diese Daten werden von
einzelnen Finanzämtern jeweils für das Gebiet der
Finanzamtsbezirke in Form der Feldschätzungsbücher vorgehalten.
Die Erlaubnis zur Dateneinsicht bzw. zum Kopieren der Daten kann
bei der Oberfinanzdirektion Kiel, Abteilung Bodenbewertung
eingeholt werden. Langfristig ist geplant, daß der Datenbestand
der Bodenschätzung zentral im LANU-SH (Abteilung 5) digital
vorgehalten wird. Aus diesem Grunde sollte vor Inangriffnahme
einer entsprechenden Bearbeitung geprüft werden, ob bereits
entsprechende Daten digital vorliegen.
Neben den Daten zur
Bodenschätzung werden, wenn vorhanden, Angaben zum
Grundwasser-Flurabstand sowie zur Hanglänge und Hangmächtigkeit
verarbeitet. Die Angaben zur Hangsituation sind im allgemeinen
der Deutschen Grundkarte 1:5000, dargestellt in Form von
Höhenlinien, zu entnehmen. Grundwasserstände lassen sich für
Flächen in direkter Vorfluternähe auch auf Grundlage der DGK5
abschätzen, ansonsten sind diese Angaben nur durch Befragungen
bzw. Vororterkundungen beschaffbar. Werden keine Angaben zur
Hang- und Grundwassersituation gemacht, so läßt das Programm
BOSSA hieran anknüpfende Bewertungsaspekte aus.
Dateneingabe
Die Weisheit "Aller Anfang
ist schwer" bleibt auch hier nicht ohne Gültigkeit. In
erster Linie ist die Übertragung dadurch erschwert, daß die
Urdaten in altdeutscher Schrift vorliegen, so daß ein gewisser
Trainingszeitraum erforderlich ist. Die Merkmalskombinationen der
Felder "horizontkennzeichnende Merkmale" werden bei der
Bodenschätzung in Form von Buchstabenkürzeln angegeben. Das
Programm bietet die Überprüfung der Dateneingabe an (Taste
Prüfung). Wird bei der Eingabe eine Zeichenfolge verwendet, die
den Regeln der Bodenschätzung nicht entspricht, so erscheint
eine entsprechende Fehlermeldung.
Als wichtiges Prinzip bei dem hier
gewählten Auswertungskonzept gilt, daß bei der Dateneingabe
keine Veränderungen gegenüber den schriftlich vorliegenden
Urdaten durchgeführt werden dürfen; d.h. es sind grundsätzlich
alle Zeichen so zu übertragen , wie sie aus den
Grablochbeschreibungen hervorgehen. Dabei sind folgende weitere
Regeln einzuhalten:
- Zwischen einzelnen Informationseinheiten
sind Leerzeichen (siehe Tabelle) zu setzen;
- die sogenannten Abschwächungszeichen
(Hochkomma) sind mit der entsprechenden Taste als (')
einzugeben (Taste # hochgestellt). Doppelte
Abschwächungszeichen werden mit 2 Eingaben dieser Taste
('') repräsentiert.
- Die sogenannten Verstärkungszeichen
werden in den schriftlichen Aufzeichnungen als Hochstrich
abgebildet. Bei der Digitalisierung wird dieses Zeichen
durch den Bindestrich ersetzt (doppelte Verstärkung =
--).
- Wichtig bei der Eingabe von Verstärkungs-
und Abschwächungszeichen ist, daß diese Zeichen
unmittelbar (ohne Leerzeicheneingabe) in Anschluß an die
Informationseinheit angehängt werden, für die sie
gelten.
- Umlaute sind jeweils als "ae",
"ue", oder "oe" einzugeben.
Um die Dateneingabe zu
erleichtern, werden bei den Feldern "Finanzamt",
"Gemeinde", "Gemarkung", "Flur" und
"Datum" die Inhalte des jeweils letzten Datensatzes
übernommen, wenn die Funktionstaste "neuer Datensatz"
betätigt wird.
Ergebnisausgabe und
-interpretation
Bei der Durchführung der
einzelnen digitalen Übersetzungs-, Ableitungs- und
Bewertungsschritte werden eine größere Anzahl von
Bodenkenngrößen profilbezogen und horizontbezogen zugeordnet.
Hierzu gehören beispielsweise Bodenartenangaben für einzelne
Horizonte, Kenngrößen zum Bodenwasserhaushalt für einzelne
Bodenhorizonte (Lagerungsdichte, Gesamtporenvolumen,
Wassergehalte bei Feldkapazität und permanenten Welkepunkt,
gesättigte Wasserleitfähigkeit) und zum Bodenstoffhaushalt
(potentielle Kationenaustauschkapazität, effektive
Kationenaustauschkapazität, Nitrat-Retentionspotential). Dabei
werden zunächst die Kenngrößen in ihren spezifischen Einheiten
als Absolutwerte bestimmt. In einem zweiten Schritt erfolgt eine
Bewertung dieser Kenngrößen entsprechend der Bodenkundlichen
Kartieranleitung 4. Auflage (Arbeitsgemeinschaft Boden, 1994).
Der Übersichtlichkeit wegen ist die Ergebnisausgabe bei BOSSA-SH
im wesentlichen auf diese Bewertungs-Parameter beschränkt:
- Feldkapazität (0 - 100 cm) (Stufe 1 - 5);
- Luftkapazität im Oberboden (Stufe 1 - 5);
- Nutzbare Feldkapazität im Wurzelraum
(Stufe 1- 5);
- Nitrat-Retentionspotential (Stufe 1 - 5);
- Wasserleitfähigkeit im Oberboden (Stufe
1- 6);
- effektive Kationenaustauschkapazität im
Oberboden (Stufe 1 - 6);
- Erosionsgefährdung (Stufe 1- 5).
Auf der Grundlage der Einstufung
der obenstehenden Kenngrößen wird eine bodenfunktionsbezogene
Bewertung des gesamten Bodenprofils durchgeführt. Es wird im
Einzelnen geprüft, wie hoch die relative Bedeutung des
betreffenden Standorts für die Landschaft in Hinblick auf
Lebensraum-, Regelungs- und Produktionsfunktion einzuschätzen
ist. Bei der Regelungsfunktion wird die Bedeutung für den
Landschaftswasserhaushalt und jene für den
Landschaftsstoffhaushalt getrennt betrachtet. Die Einstufung
erfolgt durch die Zuordnung einer dimensionslosen Zahl von 1 (=
von untergeordneter Bedeutung) bis 5 (= äußerst hohe
Bedeutung):
- Regelungsfunktion Wasserhaushalt (1 -5)
- Regelungsfunktion Stoffhaushalt
- Lebensraumfunktion
- Produktionsfunktion
Neben den genannten Angaben zur
Bodenbewertung werden folgende weitere Auswertungsergebnisse
aufgeführt:
- Bodentyp;
- Hauptbodenart;
- Nutzung;
- Besondere Merkmale (in diesem Feld wird
makiert, wenn Grundwasserstand oder Hanglänge nicht
eingegeben wurden: G=-1,H=-1).
Zeitbedarf
Hat man die Anfangsschwierigkeiten
bei der Programmbedienung und insbesondere bei der Dateneingabe
überwunden, so können bei normalem Arbeitstempo pro Stunde ca.
20 - 30 Grablochbeschreibungen eingegeben und weiterverarbeitet
werden. Für Schleswig-Holstein liegen im Schnitt 100
Grablochbeschreibungen pro DGK-5 (Deutsche Grundkarte 1:5000)
vor. Damit kann man bei einer Gemeinde durchschnittlicher Größe
von ca. 400 Beschreibungen ausgehen, was einem Arbeitsaufwand von
15 - 20 Stunden entspricht. Natürlich kann die Anzahl von
Grablochbeschreibungen pro Gemeinde von dem genannten Wert im
konkreten Fall erheblich abweichen. Bei der Zeitbedarfsberechnung
wurden zusätzliche Arbeiten, die insbesondere für die
flächenhafte Darstellung der Auswertungsergebnisse anfallen,
nicht berücksichtigt.
Bedienung des Programmes
BOSSA-SH
Der Aufbau des Programmes
entspricht der heute üblichen Fenstertechnik. D.h., daß der
Aufruf des Programmes und die einzelnen Programmfunktionen
(Aufruf einer Datei, Dateneingabe, Datenauswertung und
Datensichtung) per Mausklick erfolgt. Unterschiedliche
Bildschirmsichten (Fenster) unterstützen die einzelnen
Arbeitsschritte. Die eingegeben Daten werden zusammen mit den
Auswertungsresultaten in Dateien des Datenbankformats DBF
gehalten. Der Dateiname ist jeweils frei wählbar (maximale
Buchstabenanzahl: 8). Die Namensvergabe sollte möglichst mit
Bezug auf den betreffenden Gemeindenamen des zu bearbeitenden
Gebietes erfolgen.
Programm-Installation
Die Auslieferung der Programmes
BOSSA-SH erfolgt über drei Disketten. Die Programm-Installation
wird automatisch durch Aufruf der Windows Funktion
"Programme ausführen" bzw.
"windows-explorer" unter Angabe des Ausdrucks a:setup
durchgeführt. Bei entsprechender Anweisung ist die Diskette 2 in
das Diskettenlaufwerk einzuschieben.
Programm Starten
Das Programm ist über
Maus-Doppelklick zu starten.
Der Info-Punkt
Das Programm gliedert sich in
verschiedene Bildschirmsichten (Fenster), deren Funktionen die
Dateneingabe und die Datenansicht sowie unterschiedliche
Befehlsausführungen sind. Diese unterschiedlichen Fenster
enthalten in der unteren linken Ecke den sogenannten INFO-Punkt.
Wird dieser durch Maus-Klick aktiviert, so erscheint eine
Online-Hilfe.
Start-Bildschirmansicht
Nach dem Start des Programmes
können durch Maus-Klick 3 Funktionen ausgelöst werden:
- Anlegen einer neuen Eingabe-Datei,
- Laden einer bereits vorhandenen Eingabe-
und Resultatdatei,
- Programm beenden.
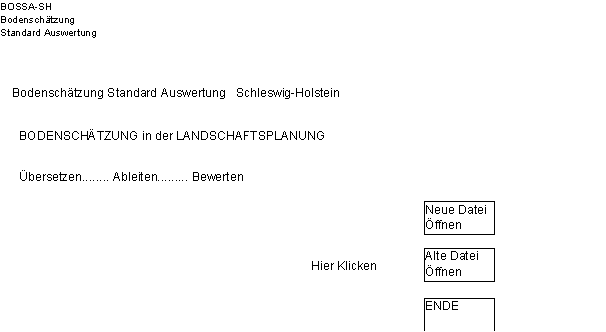
Dateien laden
In das Feld "Name der
Datei" ist der Name einer bereits vorhandenen Datei bzw. ein
neuer Dateiname einzugeben (ohne Endung .dbf). Wird bei der
Option "Neue Datei oeffnen" der Name einer schon
vorhandenen Datei genannt, so erfolgt die Aufforderung zu einer
erneuten Eingabe. Genauso wenig akzeptiert es das Programm, wenn
bei der Option "Alte Datei oeffnen" ein neuer Name
eingegeben wird. Soll eine bereits vorhandene Datei geladen
werden, so ist es möglich, den Namen dieser Datei aus dem
angelegten Verzeichnis zu übernehmen. Dazu muß das Feld
"Verzeichnis" angeklickt werden. Es erscheint eine
Liste der im Verzeichnis "BOSSA" vorhandenen Dateien.
Mit der linken Maus-Taste läßt sich die gewünschte Datei
markieren und dann mit "kopieren" und
"einfügen" (obere Symbol-Leiste) in das Feld
"Name der Datei" übertragen.
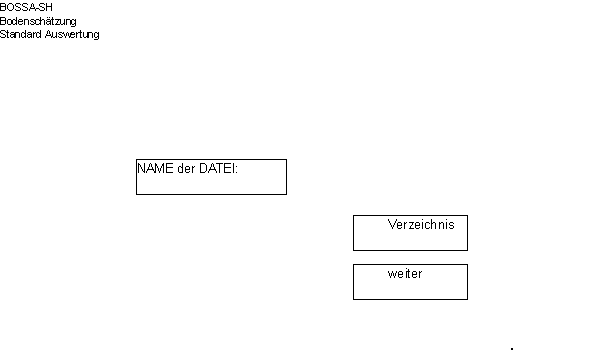
Auswahl der Routinen
Die Standard-Bearbeitung der
Bodenschätzungsdaten erfolgt durch Anklicken des Feldes
"Dateneingabe". Diese Option bietet eine Eingabemaske,
eine Überprüfungsroutine und die Auswertung einzelner
Datensätze an. Liegen Bodenschätzungsdaten bereits im
Bossa-Format als Datei vor, so ist es auch möglich, die ganze
Datei, also eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von
Profilbeschreibungen übersetzen und auswerten zu lassen.
Darüber hinaus ist es möglich, die Resultate einzusehen bzw. zu
exportieren oder auszudrucken.
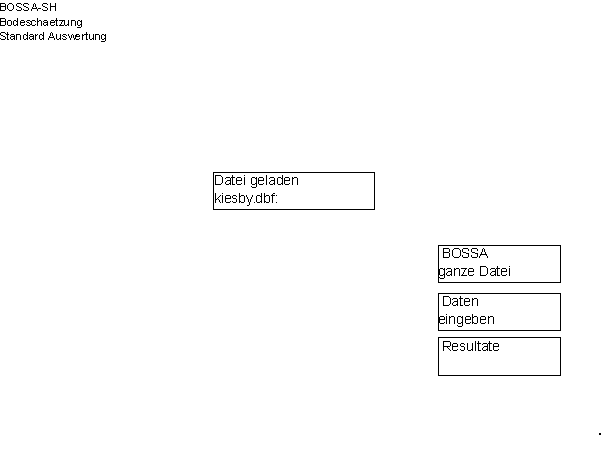
Dateneingabe
Die Eingabemaske fragt alle für
die Beschreibung eines Bodenprofils relevanten Kenngrößen ab.
Dabei werden durch die Felder der oberen zwei Zeilen
Informationen zur eindeutigen Identifizierung des Grabloches
festgehalten (Gemeinde, Gemarkung, Flur, Grablochnummer,
Tagesabschnittsnummer, Datum der Schätzung und Nachschätzung).
Besonders wichtig sind hier die Felder Gemeindename, Flur,
Tagesabschnittsnummer und Grablochnummer, da diese Informationen
eine eindeutige Lagebestimmung des Grabloches anhand der
sogenannten Schätzpausen (werden von den Katasterämtern
vorgehalten) bzw. der Schätzkarten der Finanzämter
ermöglichen. Die laufende Nummer ist eine vom Bearbeiter zu
vergebende Nummer, die sich jeweils auf einzelne Grablöcher der
Fläche einer DGK5 (Deutschen Grundkarte 1:5000) bezieht. Über
die "Laufende Nummer" läßt sich bei der weiteren
Verarbeitung der Bezug des Datensatzes zur punkt- bzw.
flächenbezogenen Position innerhalb der Karte schnell
herstellen. Die Eingabefelder der Zeilen 3 und 4 dienen der
eigentlichen Erfassung der Bodencharakteristika.
Das Klassenzeichen
beschreibt das gesamte Bodenprofil unter Angabe der
Entstehungsart (z.B. D = diluvial, Al = alluvial, V
=Verwitterungsboden, Vg =Verwitterungsböden m.hohem Steingehalt,
Lö = Löß), der Bodenart (8 Substratklassen und eine
Moorgruppe: S, Sl, lS, SL, sL, L, LT, T, Mo). Außerdem wird das
Profil in 7 Zustandsstufen bezogen auf die Bodenentwicklung
eingeteilt (7 = Rohboden bzw. verarmter Podsol, 1 = Stufe
höchster pflanzenbaulicher Leistungsfähigkeit). Bei
Beschreibungen, die sich auf Grünlandstandorte beziehen, fehlt
das Merkmal "Entstehungsart", es wird aber zusätzlich
die Angabe "Feuchtestufe" angegeben. Die Einstufung der
Böden erfolgt im Rahmen der Bodenschätzung profilbezogen durch
die Bodenzahl bzw. Grünland-Grundzahl. Die durch die sogenannten
Klassengrenzen festgelegten Teilflächen innerhalb der
Schätzkarten werden durch die "bestimmenden Grablöcher"
bodenkundlich beschrieben. Diese gelten als repräsentativ für
die jeweilige Teilfläche. Für die bestimmenden Grablöcher
werden neben der Boden- und Grünland-Grundzahl zusätzlich die
Acker- bzw. Grünlandzahl angegeben. Diese können in
Abhängigkeit von nicht bodenbedingten Standorteigenschaften um
einige Punkte von den Grundzahlen abweichen und sind in den
Feldern Klassen Zahl 1 und Klassen Zahl 2 einzugeben. In das Feld
Kulturart sind Kürzel zur Kennzeichnung des Nutzungstyps
einzugeben (A = Acker, Gr = Grünland, AGr = Mischnutzung, Ga =
Garten, F = Forst). Die wichtigste Grundlage für die Auswertung
und Bewertung der Bodenschätzungsinformationen stellen die
Felder zur Kennzeichnung der "horizontkennzeichnenden
Merkmale" dar. Im Rahmen der Bodenschätzung werden
Bodenprofile bis in eine Tiefe von 100 cm gesichtet. Dabei werden
bis zu 4 unterschiedliche Bodenhorizonte unterschieden (A-Bodengefüge,
B-Bodengefüge, C-Bodengefüge, D-Bodengefüge). Die
Merkmalskombinationen können u.a. Angaben zur Bodenfarbe, zum
Skelettanteil, zu hydromorphen Merkmalen, zum Wassergehalt, zur
Bodendichte, zu Bänderungen, zum Humusgehalt enthalten.
Obligatorisch sind die Angaben zur Bodenart bzw. zur Torfart bei
Mooren und die Horizontmächtigkeit (der jeweils unterste
Horizont wird ohne Angabe zur Horizontmächtigkeit ausgewiesen,
da sich diese immer aus der Differenz zu 100 cm ergibt). An
dieser Stelle können nicht alle im Rahmen der Bodenschätzung
verwendeten Zeichenkombinationen aufgeführt werden. Eine
ausführliche Auflistung findet sich bei BENNE et al. (1990).
In der fünften Zeile der
Eingabemaske werden drei zusätzliche Informationen abgefragt,
die nicht den Unterlagen der Bodenschätzung zu entnehmen sind: Grundwasser-Flurabstand,
Hangneigung und Hanglänge.
Auch wenn eine genaue
Einschätzung der Grundwassersituation häufig sehr schwer ist,
sollte versucht werden, anhand der vorliegenden Karten
abzuschätzen, ob es sich um einen grundwassernahen Standort mit
Flurabständen von < 1,0 m oder um grundwasserferne Standorte
handelt. Bei den Ableitungs- und Bewertungsalgorithmen wird
zwischen 4 Grundwassersituationen unterschieden ( < 0,5 m,
< 1 m , < 2 m, > 2 m). Die Erosionsgefährdung des
Standortes wird nur eingestuft, wenn Informationen zur Hanglänge
und Hangneigung vorliegen.
Bei der Bearbeitung kann man sich
entweder mittels der Maus oder mittels der Tab-Taste durch die
Maske bewegen. Um von Datensatz zu Datensatz zu wechseln, kann
man die entsprechenden Felder (<< = springe zum
Dateianfang, < springe ein Feld zurück, ,> = springe 1
Feld vor, ,>> = spinge zum Dateinende) per Mausklick
bedienen oder man kann die Tasten "Bild hoch",
"Bild tief" benutzen.
Nach Eingabe eines Datensatzes
sollte zunächst über das Anklicken des Feldes "Prüfung"
eine Kontrolle der eingegebenen Zeichenkombinationen
durchgeführt werden. Wurde zu wichtigen Merkmalen keine Angaben
gemacht bzw. wurden nicht erlaubte Zeichenkombinationen
eingegeben, so wird hierauf in einer entsprechenden
Bildschirmsicht aufmerksam gemacht. Die Eingabe kann im Anschluß
entsprechend geändert werden. Durch Mausklick auf das Feld
"BOSSA FELD" werden die Übersetzungs- und
Auswertungsroutinen gestartet. Es erscheint im Anschluß die
Ergebnisausgabe für den betreffenden Datensatz. Mit den Feldern
"Neuer Datensatz" und "Satz löschen" lassen
sich neue Datensätze hinzufügen bzw. vorhandene Datensätze
löschen.
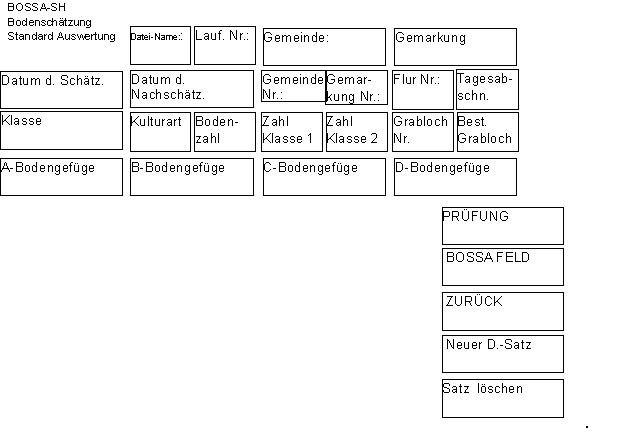
Auswertungsresultate
Die Ergebnisausgabe beschränkt
sich auf die Bodenkenngrößen, durch die eine Charakterisierung
des gesamten Bodenprofils gegeben ist.
Das Feld Bodentyp kennzeichnet den
auf der Grundlage der "horizontkennzeichnenden
Merkmale" abgeleiteten Bodentyp bzw. eine
Bodentypen-Kombination.
Folgende Bodentypen werden
berücksichtigt:
| Kürzel |
Bodentyp |
| MC |
Kalkmarsch |
| MN |
Kleimarsch |
| MD |
Dwogmarsch |
| MK |
Knickmarsch |
| MO |
Organomarsch |
| GH |
Moorgley |
| GM |
Anmoorgley |
| G-H |
Moorgley |
| GN |
Nassgley |
| G-P |
Gley-Podsol |
| H-P |
Moor-Podsol |
| HN |
Niedermoor |
| G |
Gley |
| S |
Pseudogley |
| B |
Braunerde |
| L |
Parabraunerde |
| K |
Kolluvisol |
| P |
Podsol |
| RQ |
Regosol |
| OL |
Locker-
Syrosem |
Das Feld "Hauptbodenart"
beschreibt die Substratsituation für das gesamte Profil.
Folgende Einträge sind möglich:
| Kürzel |
Bodenart |
Kürzel |
Bodenart |
| S |
Sand |
HN |
Torf |
| sL |
sandiger Lehm |
HN üb. S |
Torf über
Sand |
| S üb. L |
Sand über
Lehm |
HN üb. L. |
Torf über
Lehm |
| L |
Lehm |
HN üb. U |
Torf über
Schluff |
| U |
Schluff |
HN üb. T |
Torf über
Ton |
| T |
Ton |
|
|
Das Feld "H.-Nutzung"
bezeichnet die Hauptnutzungsart (Acker, Acker + Grünland,
Grünland, Garten, Forst).
Die Parameter Feldkapazität (FK),
Luftkapazität im Oberboden (LK), Erosion, nutzbare
Feldkapazität im Wurzelraum (NFK), gesättigte
Wasserleitfähigkeit im Oberboden (KF), effektive
Kationenaustauschkapazität im Oberboden,
Nitrat-Retentionspotential werden in Form von dimensionslosen
Wertstufen ( 1 - 5 bzw. 1 - 6) abgebildet. Nähere Erläuterungen
zu diesen Einstufungen können dem folgenden Kapitel entnommen
werden.
Die Einstufung entsprechend der
unterschiedlichen Bodenfunktionen wird auf der Grundlage der im
folgenden Kapitel aufgeführten Tabellen durchgeführt.
Neben den zusammenfassenden
Ergebnissen wie Bodentyp, Hauptbodenart und
Bodenfunktionsbewertungen liefert BOSSA-SH eine große Anzahl von
Detailinformationen. Diese befinden sich nicht in der
Eingabedatei, deren Namen vom Bearbeiter vergeben wird, sondern
sie sind in der Datei "Bossdat" abgelegt. Diese Datei
darf nie glöscht werden, kann aber nach Bearbeitung der gesamten
Datei (Taste: "BOSSA-Ganze Datei") kopiert werden. Sie
enthält neben den Eingabedaten, die hier gegebenenfalls leicht
modifiziert abgespeichert sind, bodenhorizontbezogene Angaben zur
Körnung, zum Humusgehalt, zur Lagerungsdichte, zu den
unterschiedlichen pF-Wertstufen und vieles mehr. Im Anhang dieser
Beschreibung befindet sich eine Beschreibung der einzelnen Felder
dieser Datei. Will man ihren Inhalt nutzen, so sind folgende
Hinweise wichtig:
- BOSSDAT enthält nur die
Übersetzungsergebnisse eines vollständigen
Eingabedatensatzes, wenn die Übersetzung mit "BOSSA
ganze Datei" gestartet wurde. Ansonsten werden hier
immer nur Ergebnisse des jeweils aktuell übersetzten
Datensatzes abgelegt.
- BOSSDAT darf nie gelöscht oder umbenannt
werden, sondern muß zur Weiterverwendung kopiert werden.
- BOSSDAT liegt im DBF-Format vor und kann
problemlos in eine ander Software, wie EXCEL, ARC-VIEW
etc. eingelesen werden.

BOSSA-Ergebnisansicht
Landschaftsbezogene
Bodenbewertung
Eine wesentliche Aufgabe der
Landschaftsplanung ist es darzustellen, welche Maßnahmen zur
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auf lokaler Ebene notwendig sind. (§ 6, Abs. 1
BNatSchG.). Im Einzelnen sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen: Schutz, Pflege und Entwicklung der
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit
der Naturgüter, der Pflanzen und Tierwelt sowie der Vielfalt,
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als
Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine
Erholung (§ 1, Abs. 1 BNatschG). Von diesen den Naturhaushalt
insgesamt umfassenden Zielsetzungen lassen sich spezifische
Anforderungen für die Behandlung einzelner Umweltmedien
ableiten. Böden sind wichtige Bestandteile von Natur und
Landschaft und somit Schutzgüter im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes. Folglich ergibt sich die Notwendigkeit
einer ausreichenden Berücksichtigung des Schutzes von Böden im
Rahmen von Landschaftsplanungsverfahren.
Laut LNatSchG S-H ist der Erhalt
der ökologischen Funktionen der Böden zu sichern. Um das zu
erreichen, müssen Belastungen des Bodens, die durch die
Bodennutzung entstehen können, so gering wie möglich gehalten
bzw. durch entsprechende Schutzmaßnahmen auf ein tolerierbares
Maß reduziert werden. Der im Rahmen des
Landschaftsplanungsverfahrens zu erstellende Grundlagenteil
sollte u.a. eine räumliche differenzierende Beschreibung zur
Bodensituation beinhalten. Diese liefert die Basis für eine
Bewertung der Funktionsfähigkeit der Böden bei bestehender und
geplanter Nutzung. Hierauf aufbauend ist es möglich, im Abgleich
mit bestehenden Nutzungsinteressen Nutzungsempfehlungen zu
formulieren.
Als Bewertungsgrundlage sollten
die dem Umweltmedium Boden zugeordneten Funktionen herangezogen
werden (Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion, Archivfunktion,
Produk-
tionsfunktion). Um für einzelne
Standorte und ihre Böden Aussagen über den Grad der
Funktionserfüllung bei unterschiedlichen Nutzungen zu liefern,
ist es wichtig, bodenbezogene Indikatorgrößen mit hohem
funktionsspezifischem Informationsgehalt zu benennen, welche im
Rahmen einer Bestandsaufnahme flächenhaft erfaßbar sind.
Bodenfunktionen und wichtige Kenngrößen
für ihre Bewertung
Tabelle 1: Bodenfunktionen im Überblick.
| Ökologische
Bodenfunktionen |
Der Boden
ist............................ |
| Lebensraumfunktion Regelungsfunktion
Archivfunktion
|
Lebensgrundlage
und Lebensraum f. Pflanzen, Tiere u. Menschen (inkl.
Bodenfauna u. -flora) Filter,
Puffer, Transformator, Quelle, Speicher
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
|
| Bodenfunktionen,
die grundsätzlich mit den Ansprüchen des Natur- u.
Landschaftsschutzes vereinbar sein können. |
Der Boden
ist.................................. |
| Produktionsfunktion Erholungsfunktion
|
Grundlage
für die Produktion von Biomasse Erholungsraum
|
| Nichtökologische
Bodenfunktion |
Der Boden
ist............................. |
| Standortfunktion
Entsorgungsfunktion
Lagerstättenfunktion
|
Standort für
Siedlung, Gewerbe,Industrie, Verkehr etc., Deponie für Abfälle
Lagerstätte für Bodenschätze und
Energiequellen
|
Ein wichtiger Aspekt für die
ökologisch orientierte Bewertung von Böden muß die
Leistungsvielfalt sein, die diese im Natur- und Kulturhaushalt
erbringen. Es kann zwischen Bodenfunktionen unterschieden werden,
die von hoher ökologischer Bedeutung sind (z.B. die
Lebensraumfunktion und die Regelungsfunktion) und solchen, die
eher eine Beeinträchtigung für die Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes zur Folge haben (z.B. Standort für Siedlung,
Wirtschaft und Verkehr, Lagerstätten und Ablagerungen). Die
Produktions- und die Erholungsfunktion von Böden lassen sich
diesen Rubriken nicht pauschal zuordnen, so daß für diese eine
dritte Kategorie gewählt wurde.
Wie von dem Arbeitskreis
3 'Bodenschutz - Planung' der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft
'Bodenschutz' im einzelnen
ausgeführt wird, muß vor einer detaillierten Bewertung der
Leistungsfähigkeit von Böden überprüft werden, inwieweit
anthropogene Einflüsse zu einer erheblichen oder nachhaltigen
Beeinträchtigung geführt haben bzw. führen können. Die
Schutzwürdigkeit von Böden ergibt sich aus ihrer
Leistungsfähigkeit, wobei empfindliche Böden besonders
schutzbedürftig sind. Hier gilt es, Beeinträchtigungen durch
Bodenerosion, Bodenverdichtung, Stoffeinträge etc. zu verhindern
oder durch entsprechende an den Standort angepaßte Maßnahmen zu
mindern. Im folgenden werden die aus Sicht des Natur- und
Landschaftsschutzes relevanten Bodenfunktionen
(Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion, Archivfunktion,
Produktionsfunktion) näher beschrieben und Möglichkeiten
dargestellt, die Leistungsfähigkeit einzelner Böden auf der
Grundlage von einfach zu erhebenden Kenngrößen einzuschätzen.
Lebensraumfunktion
Böden sind Lebensraum und
Lebensgrundlage für eine Vielzahl von Mikroorganismen, Pflanzen
und Tiere. Für das Wachstum terrestrischer Pflanzenarten sind
sie substantiell, indem sie Wurzelraum bieten sowie die Wasser-
und Nährstoffversorgung gewährleisten. Für die Bewertung von
Böden hinsichtlich ihrer Lebensraumfunktion sind die Aspekte
Nährstoffhaushalt, Wasserhaushalt und Lufthaushalt besonders
relevant. Als Nährstoffquelle der meisten heterotroph lebenden
Organismen dient der Humus bzw. frisch zugeführte organische
Substanz. Für die Aufrechterhaltung einer permanent hohen
biologischen Aktivität ist daher ein ausreichender Ersatz der zu
Kohlendioxid veratmeten organischen Substanz durch Pflanzenreste
und tierische Exkremente erforderlich. Die Zusammensetzung der
Bodenorganismen wird sehr stark durch den Wasser- und Luftgehalt
von Böden gesteuert, da die einzelnen Organismengruppen
unterschiedliche Optima besitzen. Auch der Schadstoffgehalt von
Böden hat einen Einfluß auf die Lebensraumfunktion. Bei
Überschreiten des "Non-effect-levels" wirken sowohl
organische als auch anorganische Schadstoffe bei Pflanzen und
Tieren ertrags- und wachstumsmindernd. Um ein möglichst breites
Spektrum an Bodenorganismen in einer Landschaft zu erhalten bzw.
wieder einzubürgern, empfiehlt es sich, die natürliche
Heterogenität an unterschiedlichen Böden zu erhalten, d.h.,
eine Nivellierung zu vermeiden. Insbesondere sind Böden, die nur
gering anthropogen beeinflußt sind, bezüglich ihrer
Lebensraumfunktion hoch einzuschätzen.
Böden in ihrer Funktion als Archiv der
Naturgeschichte
Böden entstehen an der
Erdoberfläche aus Gestein. Die Bodengenese erfolgt unter
spezifischen Klimabedingungen sowie unter dem Einfluß von
Vegetation und Fauna. Im Laufe der Zeit kann eine Vielzahl von
vertikal und lateral gegliederten Bodenstrukturen entstehen. Aus
der Interpretation von Bodenprofilen lassen sich Informationen
über Umweltbedingungen (Klima, Vegetation, Fauna, Hydrologie,
anthropogene Einflüsse) ableiten, wie sie in unterschiedlichen
Phasen der Bodenbildung geherrscht haben. Böden sind daher auch
in ihrer Funktion als erd- und landschaftsgeschichtliche Urkunden
einzuordnen. Von besonderem bodenkundlichen Interesse sind dabei
häufig die in früheren Zeiten entstandenen Paläoböden. Sie
blieben entweder als fossile Böden unverändert erhalten, da
ihre Entwicklung durch Sedimentüberlagerungen unterbrochen
wurde, oder sie befinden sich als Reliktböden an der
Erdoberfläche und unterliegen damit weiterhin der
Bodenentwicklung. Es läßt sich darüber hinaus einer Reihe von
rezenten Böden eine große Bedeutung in Hinblick auf die
Archivfunktion zuweisen. Die Informationen, die sich durch eine
fachgerechte Analyse von Bodenprofilen und ihrer Genese ableiten
lassen, können wertvolle Hinweise für die zukünftige
Entwicklung von Böden - beispielsweise unter geänderten
Nutzungs- oder Klimabedingungen - liefern.
Regelungs- und Transformationsfunktion
Das Puffer- und Filtervermögen
von Böden stellt einen wichtigen Aspekt für die
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes dar. Hierdurch können
Schadstoffe immobilisiert werden, d.h., ein Weitertransport in
Grund- und Oberflächenwässer sowie die Aufnahme durch
Pflanzenwurzeln wird verhindert bzw. eingeschränkt. Darüber
hinaus können organische Schadstoffe durch Mikroorganismen zu
ungefährlichen Kohlenstoffverbindungen (z.B. CO2) abgebaut
werden.
Die Filterfunktion ergibt
sich aus der Fähigkeit der Böden, Stoffe aus dem
Niederschlags-, Sicker- und in Teilbereichen auch aus dem
Grundwasser im Porensystem mechanisch zurückzuhalten. Die
Filterleistung hängt wesentlich von der Infiltrationskapazität
ab. Diese ist wiederum als Funktion des Porenspektrums zu
beschreiben. Je grobkörniger der Boden ist, desto höher ist
sein Filtervermögen. Als geeignetes Maß zur Beschreibung der
Infiltrationskapazität läßt sich die Luftkapazität des oberen
Bodenhorizontes verwenden. Dieser Parameter gibt an, wieviel
Wasser kurzfristig vom Boden aufgenommen werden kann. Sand- und
besonders schluffreiche Böden sind im Vergleich zu tonreichen
Böden durch hohe Luftkapazitäten gekennzeichnet. Um die
stoffbezogene Gesamtfilterwirkung zu beschreiben, bietet sich
eine kombinierte Einstufung der Parameter Luftkapazität und
Kationenaustauschkapazität an.
Die Pufferfunktion umfaßt
die Ausgleichswirkung der Böden gegenüber natürlichen und
anthropogenen Stoffeinträgen. Die Pufferwirkung bedingt, daß
gasförmige und vor allem gelöste Schadstoffe durch Adsorption
an die Bodenaustauscher gebunden oder nach Reaktion mit
bodeneigenen Substanzen chemisch gefällt und damit temporär
oder dauerhaft festgelegt werden. Es können sowohl Kationen als
auch Anionen sowie neutrale Moleküle sorbiert werden. Als
Adsorbenten wirken vor allem Tonminerale, Huminstoffe und
Metalloxide. Zu beachten ist, daß nicht biologisch oder chemisch
abbaubare Stoffe (z.B. Schwermetalle) nur in begrenzten Mengen
sorbiert werden können, d.h. die Anzahl der Sorptionsplätze ist
begrenzt. Die Adsorption von Kationen und Anionen erfolgt nie
vollständig, d.h. eine Restkonzentration verbleibt in der
Bodenlösung. Das Verhältnis zwischen gelösten und adsorbierten
Stoffanteilen hängt von der Adsorptionskapazität des jeweiligen
Bodens und von der jeweiligen bereits adsorbierten Stoffmenge ab.
Allgemein läßt sich daraus folgern, daß sich mit steigenden
Schadstoffgehalten das Vermögen, zusätzliche Mengen zu puffern,
verringert.
Unter dem Begriff Transformationsfunktion
wird die Eigenschaft von Böden verstanden, organische Stoffe wie
Pflanzenreste oder vom Menschen eingetragene organische Dünger
oder Pflanzenschutzmittel und z.T. auch anorganische Stoffe (z.B.
Nitrat) ab- bzw. umzubauen. Die Abbaugeschwindigkeiten hängen
entscheidend von den Lebensbedingungen der Bodenorganismen ab.
Diese sind optimal bei Temperaturen von 25-30° C, neutraler bis
schwach alkalischer Reaktion und einem guten Nährstoffangebot
für die abbauenden Organismen.
Die Speicher- und
Quellenfunktion des Bodens umfaßt die Fähigkeit, Wasser und
Nährstoffe zu binden und über einen längeren Zeitraum wieder
abgeben zu können. Sie hat damit eine große Bedeutung für die
Lebensraumfunktion und Produktionsfunktion des Bodens. Das
Vermögen des Bodens, Wasser zu halten, hängt in erster Linie
von der Porengrößenverteilung und damit von der Bodenart, dem
Humusgehalt und der Lagerungsdichte ab. Die bodenkundlichen
Parameter 'Gesamtporenraum', 'Feldkapazität' und 'permanenter
Welkepunkt' stellen wichtige Kenngrößen zur Charakterisierung
des Wasserhaltevermögens dar.
Nährstoffe können an der
Oberfläche von organischen und anorganischen Bodenbestandteilen
gespeichert werden. Je nach Stärke der Sorption liegen sie in
einer schwer oder leicht austauschbaren Form vor und sind damit
kurz-, mittel- oder langfristig pflanzenverfügbar. Ähnlich wie
bei der Pufferung von Schwermetallen spielt auch hier die
Fähigkeit der Böden, Kationen reversibel festzulegen, eine
wichtige Rolle. Die wichtigsten austauschbaren Kationen sind Ca-,
Mg-, K-, Na- sowie Al- und H-Ionen, in geringeren Mengen
Ammonium- und Eisen-Ionen und in Spuren Mangan-, Kupfer- und
Zink-Ionen. Die Summe der potentiell austauschbaren Kationen
eines Bodens wird durch die Kationenaustauschkapazität
beschrieben. Diese hängt in erster Linie vom Humus- und
Tongehalt ab sowie von deren spezifischen Eigenschaften (z.B.
Tonmineralzusammensetzung, Zersetzungsgrad der organischen
Substanz etc.). Der Austausch von Anionen (z.B. Phosphat, Sulfat,
Nitrat, Chlorid) erfolgt in ähnlicher Weise, allerdings im
geringeren Ausmaß, wobei die Tonminerale, die Hydroxide und die
organische Substanz die positiv geladenen Austauschplätze
bieten. Darüber hinaus liegen größere Nährstoffmengen als
inkorporierte Bestandteile der organischen Substanz des Boden
vor. Dies gilt insbesondere für den weitaus größten Anteil des
Bodenstickstoffvorrats, aber zu geringeren Anteilen auch für
Phosphate und andere Nährelemente. Diese organisch gebundenen
Nährstoffanteile werden durch die Zersetzer- und
Humifizierungstätigkeit der Bodenorganismen mineralisiert und
damit pflanzenverfügbar gemacht. Weiterhin setzen die in Böden
ständig ablaufenden Verwitterungsprozesse kontinuierlich, wenn
auch kurzfristig im geringen Maße, Nährstoffe wie Kalium,
Magnesium, Calcium, Eisen und Mangan frei.
Produktionsfunktion
Der Land-, Garten- und
Forstwirtschaft dient der Boden als Produktionsfaktor für die
Herstellung von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und pflanzlichen
Rohstoffen. Der Begriff Bodenfruchtbarkeit faßt alle Aspekte
zusammen, die für die Fähigkeit des Bodens, pflanzliche
Biomasse zu produzieren, ausschlaggebend sind. Die 'natürliche
Fruchtbarkeit' eines Standortes ist um so größer, je höher die
Biomassenproduktion pro Flächeneinheit, je vielfältiger die
Vegetation und je geringer die jährlichen
Produktionsschwankungen sind. Einen Anhalt für die
Ertragsfähigkeit von Böden geben die Bewertungszahlen der
Bodenschätzung. Im allgemeinen sind Standorte mit hohen
Ackerzahlen besonders für die landwirtschaftliche Nutzung
geeignet, da diese Böden hohe Erträge liefern und hier eine den
Anforderungen des Landschafts- und Naturschutzes Rechnung
tragende Bewirtschaftungsweise vergleichsweise geringe
umweltrelevante Nebenwirkungen mit sich führt. Für Standorte,
die in ihrer Produktionsfunktion gering eingestuft werden, ist
gegebenenfalls eine Umwidmung zugunsten anderer Nutzungen zu
empfehlen.
Bodenfunktionen als Grundlage
für eine standortbezogene Bewertung der Nutzungseignung
Nicht alle Böden erfüllen die
verschiedenen hier genannten Funktionen in gleicher Weise. Es
gehört u.a. zu den Aufgaben der Landschaftsplanung, räumlich
differenziert aufzuzeigen, welchen Böden aufgrund ihrer
spezifischen Eigenschaften bestimmte Funktionsbereiche prioritär
zuzuordnen sind. Wie im vorausgehenden Kapitel beschrieben,
lassen sich bestimmte Aspekte, wie beispielsweise Charakteristika
des Bodenwasser- und des Bodennährstoffhaushalts heranziehen, um
Aussagen über die Relevanz bestimmter Funktionen für einzelne
in der Landschaft anzutreffende Böden abzuleiten. Bestimmte
durch Feldkartierung aufzunehmende oder aus
Bodenschätzungsunterlagen zu übernehmende Indikatorgrößen
eignen sich als Einstufungsgrundlage, so daß Aussagen zu den
einzelnen Bewertungsaspekten abgeleitet werden können.
Tab. 2: Bewertungsaspekte und Indikatorgrößen
als Grundlage für die Einstufung der Funktionsfähigkeit von
Böden.
| Bodenfunktion |
Bewertungsaspekt
1) |
Indikatorgrößen
2) |
| Lebensraum- funktion
|
Grad der
anthropogenen Einflußnahme, Vielfalt
an unterschiedlich ausgestatteten Böden (zu
charakterisieren durch Eigenschaften des Wasserhaushalts,
Nährstoffhaushalts, Lufthaushalts, Humusgehalts)
|
Nutzungsintensität,
Nährstoff- und Schadstoffgehalt, pH-Wert, Bodenabtrag,
Bodenauftrag, Entwässerung, Bodenart,
Bodentyp, Lagerungsdichte, Humusgehalt,
Kationenaustauschkapazität, effektiver Wurzelraum,
Gesamtporenvolumen, nutzbare Feldkapazität,
Grundwasserflurabstand.
|
| Regelungs- funktion
|
Infiltrationskapazität,
Wasserspeicherkapazität, Sorptionsvermögen durch
Tonminerale, Metalloxide und organische Substanz,
mikrobielle Aktitvität. |
Nutzungsart
und -intensität, Bodenart, Humusgehalt, Lagerungsdichte,
kf-Wert , Luftkapazität, Feldkapazität, Bodenfarbe,
Kationenaustauschkapazität, pH-Wert, Schadstoffgehalte. |
| Archivfunktion |
Seltenheit,
bodengenetische Besonderheit |
Seltenheit
und Signifikanz bodenkundlicher Merkmale (besondere
Horizontabfolgen, Horizontmächtigkeiten, Substrattypen,
Bodentypen) |
| Produktions- funktion
|
Wasserspeicherver- mögen, Nährstoffspei-
chervermögen, Lufthaushalt, Bearbei-
tungsbedingungen
|
Bodenart,
Humusgehalt, Lagerungsdichte,
Kationenaustauschkapazität, Nährstoff- und
Schadstoffgehalt, Gefälle, nutzbare Feldkapazität,
Grundwasserflurabstand. |
1) Für den Begriff
"Bewertungsaspekt" wird im LABO-AK3 auch der Begriff
"Kriterien" als Synonym verwendet.
2) Für den Begriff "Indikator" wird
im LABO-AK3 auch der Begriff "Parameter" als Synonym
verwendet.
Einstufung der Funktionsfähigkeit von
Böden auf Grundlage bodenkundlicher Kenngrößen
Kenngrößen zur Charakterisierung des
Bodenwasserhaushalts
Die Feldkapazität gibt an,
wieviel Wasser ein Boden entgegen der Schwerkraft halten kann,
sie kennzeichnet also das Wasserhaltevermögen von Böden. Da mit
dem Wasser gleichzeitig gelöste Stoffe gehalten werden, kann die
Feldkapazität auch als Maß für die Fähigkeit des Bodens
verwendet werden, die vertikale Verlagerung von leicht löslichen
Stoffen wie Nitrat oder Chlorid zu verlangsamen. Damit ist die
Feldkapazität sowohl eine wichtige Größe zur Charakterisierung
von Böden hinsichtlich ihrer Lebensraum- und Produktionsfunktion
(hohe Feldkapazität = hoher Wasservorrat), als auch hinsichtlich
ihrer Regelungsfunktion (bei hohen Feldkapazitäten ist die
Verlagerungsgeschwindigkeit des Sickerwassers und darin gelöster
Stoffe gering, ein höherer Anteil an Wasser und gelösten
Stoffen ist pflanzenverfügbar bzw. über einen längeren
Zeitraum pflanzenverfügbar.
Tabelle 3: Einstufung der Feldkapazität
berechnet für 10 dm Profiltiefe (KA4, Tab. 59).
| Kurz- zeichen
|
Bezeichnung |
Feldkapazität
|
| |
|
in l/m3 |
in Vol.-% |
| FK1 FK2
FK3
FK4
FK5
|
sehr gering gering
mittel
hoch
sehr hoch
|
< 130 130 - 260
260 - 390
390 - 520
> 520
|
< 13 13 - 26
26 - 39
39 - 52
> 52
|
Mit Feldkapazität bezeichnet man den Teil des
Bodenwassers, der im Porenraum entgegen der Schwerkraft maximal
gehalten werden kann.
Abkürzungen: FK = Feldkapazitätsstufe
Vol.-% = Wassergehalt angegeben als
Volumenprozent
Während durch die Feldkapazität
die gesamte Wassermenge beschrieben wird, die vom Boden entgegen
der Schwerkraft gehalten wird, gibt die nutzbare
Feldkapazität den Anteil an, der für die Aufnahme durch die
Pflanzenwurzel verfügbar bleibt, also nicht zu fest an den
Bodenkörper gebunden ist. Die Einstufung bezieht sich auf den
oberen Bodenkörper, der vor allem für die Wurzelaufnahme und
damit für die Transpiration durch Pflanzen zur Verfügung steht
(effektiver Wurzelraum). Dieser Parameter ist besonders wichtig
für die Bewertung von Böden hinsichtlich ihrer Lebensraum- und
Produktionsfunktion.
Tabelle 4: Einstufung der nutzbaren
Feldkapazität des effektiven Wurzelraumes (Quelle: Tab. 60 KA4).
| Kurzzeichen |
Bezeichnung |
nFK in mm |
| nFK1 |
sehr gering |
< 60 |
| nFK2 |
gering |
60 - 140 |
| nFK3 |
mittel |
140 - 220 |
| nFK4 |
hoch |
220 - 300 |
| nFK5 |
sehr hoch |
> 300 |
Mit "nutzbarer Feldkapazität"
bezeichnet man den Anteil des maximal gegen die Schwerkraft
gehaltenen Bodenwassers, welcher von Pflanzenwurzeln aufgenommen
werden kann.
Abkürzungen: nFK1 = Klassenbezeichnung der
nutzbaren Feldkapazität
Mit Luftkapazität bezeichnet
man den Teil des Porenraumes, der unter Bedingungen, wie sie für
die Feldkapazität gelten, wasserfrei bleibt. Folglich ergibt die
Summe aus Feldkapazität und Luftkapazität das
Gesamtporenvolumen. Die Luftkapazität läßt sich als Maß zur
Charakterisierung der Speicherfähigkeit von Grund- und
Stauwasser heranziehen. Damit ist eine weitere
Bewertungsmöglichkeit des Bodens hinsichtlich seiner
Regelungsfunktion mit Bezug auf den Wasserhaushalt gegeben.
Tabelle 5: Einstufung der Luftkapazität des
Bodens. (Quelle: Tab. 61, KA4).
| Kurzbezeichnung |
Bezeichnung |
Luftkapazität
in Vol.-% |
| LK1 |
sehr gering |
< 2 |
| LK2 |
gering |
2 - 4 |
| LK3 |
mittel |
4 - 12 |
| LK4 |
hoch |
12 - 20 |
| LK5 |
sehr hoch |
>20 |
Mit Luftkapazität bezeichnet man den
Teil des Porenraumes, der unter Bedingungen, wie sie für die
Feldkapazität gelten, wasserfrei bleibt.
Abkürzungen: LK1 = Lufkapazitätsklasse 1
Vol% = luftgefüllter Porenraum angegeben in
Volumenprozent
Der kf-Wert als Größe zur
Kennzeichnung der Wasserleitfähigkeit in gesättigten
Böden ist ein wichtiges Maß für die Beurteilung des
Filtervermögens, der Erosionsanfälligkeit sowie der
Dränwirksamkeit des Bodens. Neben dem Wasserhaltevermögen
bestimmt die Wasserleitfähigkeit, mit welcher Geschwindigkeit
sich das auf die Bodenoberfläche eingetragene
Niederschlagswasser in Richtung Grundwasser bzw. Vorflut
verlagern kann. Ist die Durchlässigkeit gering, so ist die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Oberflächenwasser und
damit die Verschlämmungs- und Erosionsgefährdung groß. Ebenso
kann es zu Stauwasser oberhalb des wenig durchlässigen
Bodenhorizontes kommen. Geringe Mineralisationsraten, hohe
Denitrifikationsleistungen und eine langsame Bodenerwärmung im
Frühjahr sind charakteristische Merkmale für staunasse
Standorte.Der kf-Wert ist in erster Linie interessant, um die
Regelungsfunktion des Bodens mit Bezug auf den Wasserhaushalt und
insbesondere die Filtereigenschaften zu bewerten. Darüber hinaus
liefert dieser Parameter aber auch Hinweise für die
Einschätzung der Lebensraum- und Produktionsfunktion.
Tabelle 6: Einstufung der
Wasserdurchlässigkeit im wassergesättigten Boden (Quelle: Tab.
64, KA4).
| Kurz- zeichen
|
Bezeichnung |
kf-Werte
|
| |
|
in cm/d |
| kf1 kf2
kf3
kf4
kf5
kf 6
|
sehr gering gering
mittel
hoch
sehr hoch
äußerst hoch
|
<1 1 - 10
10 - 40
40 - 100
100 - 300
> 300
|
Abkürzungen:
kf-Wert = Maßzahl für die
Wasserleitfähigkeit wassergesättigter Böden
kf1 = kf-Klasse 1
cm/d = cm pro Tag
Kenngrößen zur Charakterisierung des
Bodenstoffhaushalts
Die Kationenaustauschkapazität
(KAK) beschreibt das Vermögen eines Bodens, Kationen reversibel
zu binden. Diese Eigenschaft hängt besonders vom Tongehalt und
vom Gehalt an organischer Substanz ab. Sie ist sowohl für den
Nährstoffhaushalt von Böden von besonderer Relevanz als auch
für das Pufferungsvermögen gegenüber eingetragenen
Schadstoffen. Somit sollte sie herangezogen werden, wenn es um
die Beurteilung der Regelungs- und Produktionsfunktion von Böden
geht. Während die potentielle KAK von den Kenngrößen
Humusstufe und Substratklasse ableitbar ist, erfolgt die
Abschätzung der effektiven KAK unter Einbeziehung des aktuellen
pH-Wertes. Da pH-Messungen im Rahmen der Bodenschätzung nicht
durchgeführt werden und pH-Werte ohnehin als zeitlich variable
Größen anzusehen sind, wird die effektive KAK durch BOSSA-SH
unter Verwendung der laut LUFA für unterschiedliche Bodenarten
und Nutzungen empfohlenen Soll-pH-Werte abgeschätzt. Da der
mittlere pH-Wert eines landwirtschaftlich genutzten Bodens in der
Regel unterhalb des empfohlenen pH-Wertes liegt erfolgt ein Abzug
von 0,3 pH-Einheiten.
Tabelle 7: Einstufung der eff.
Kationenaustauschkapazität von Böden (Quelle: Tab. 73, KA4).
| Kurzbezeichnung |
Bezeichnung |
KAK (cmolc
/kg Boden) |
| KAK1 |
sehr gering |
< 4 |
| KAK2 |
gering |
4 - 8 |
| KAK3 |
mittel |
8 - 12 |
| KAK4 |
hoch |
12 - 20 |
| KAK5 |
sehr hoch |
20 - 30 |
| KAK6 |
äußerst
hoch |
>30 |
Die Kationenaustauschkapazität (KAK)
beschreibt das Vermögen des Bodens, Kationen reversibel zu
binden.
Ankürzungen: KAK1 =
Kationenaustauschkapazitäts-Klasse 1
cmolc = centi mol charge
Zur Abschätzung des "Nitrat-Retentionsvermögens"
wird die Feldkapazität (0-10 dm Bodentiefe) in Beziehung zu
einer durchschnittlichen jährlichen Sickerwasserrate gesetzt.
Durch ein einfaches Rechenverfahren (Iteration über 180
Tagesschritte und 10 Bodenkompartimente) läßt sich eine Aussage
darüber machen, wieviel des im Herbst vorliegenden
Nitrat-Vorrats bis zur nächsten Vegetationsperiode durch das
Sickerwasser in nicht mehr von Pflanzenwurzeln erreichbare
Bodentiefen verlagert wird. Die Indikatorgröße
Nitrat-Retentionsvermögen liefert einen Hinweis darüber,
inwiefern ein Boden unter gegebenen Klimaverhältnissen für den
Anbau düngungsintensiver landwirtschaftlicher Kulturarten
geeignet ist.
Tabelle 8: Einstufung des
Nitrat-Retentionsvermögens.
| Kurzbezeichnung |
Bezeichnung |
Nitrat-Retention
in Prozent eines herbstlichen Anfangs-Nmin-Wertes |
| NR1 |
äußerst
gering |
>85 |
| NR2 |
gering |
75 -85 |
| NR3 |
gering bis
mittel |
50 - 75 |
| NR4 |
mittel bis
hoch |
30 - 50 |
| NR5 |
hoch |
<30 |
Unter Nitrat-Retentionsvermögen wird die
Fähigkeit des Bodens verstanden, Nitrat und andere gelöste
Stoffe während des Winterhalbjahres im durchwurzelten
Bodenbereich zu halten.
Abkürzungen: NR1 = Nitrat-Retentionsklasse
Nmin = in mineralischer Bindungsform
vorliegender Stickstoffanteil (Nitrat und Ammonium).
Kenngrößen zur Einstufung der
Empfindlichkeit von Böden gegenüber Nutzungseinflüssen
Bei der Bewertung von Böden muß
neben dem Aspekt der Funktionsfähigkeit auch eine Betrachtung
der Schutzbedürftigkeit erfolgen. Böden sind dann besonders
schutzbedürftig, wenn für sie ein besonders hohes Risiko
besteht, daß nutzungsbedingte Eingriffe zu gravierenden,
irreversiblen Veränderungen führen. Dies ist z. B. bei Moorböden
der Fall. Hier bewirken Entwässerungsmaßnahmen eine rasche
Mineralisierung des Moorkörpers. Die Empfindlichkeit von Gleyböden
gegenüber Entwässerungsmaßnahmen ist ähnlich hoch.
Als erosionsgefährdet müssen
alle Böden angesehen werden, deren Oberfläche geneigt ist. Ob
es tatsächlich zu einer Bodenzerstörung durch abfließendes
Oberflächenwasser kommt, hängt vor allem von der Art der
Vegetationsbedeckung ab. Handelt es sich um einen Ackerstandort,
so bestimmt die Anbaufrucht bzw. die Fruchtfolge die Höhe des
Bodenabtrags im entscheidenden Maße (C-Faktor).
Tabelle 9: Zuordnung von C-Faktoren zu
unterschiedlichen Fruchtfolgesystemen (MEYER & REICHE 1997)
| Fruchtfolgetyp |
C-Faktor |
| Weizen-Gerste-Raps |
0.095 |
| Weizen-Gerste-Zuckerrüben |
0.154 |
| Roggen-Weizen-Futterpflanzen |
0.064 |
| Roggen-Weizen-Mais |
0.174 |
| Grünland |
0.04 |
Der C-Faktor
beschreibt die erosionshemmende Wirkung des Vegetation.
Der K-Faktor beschreibt die
bodenspezifische Erodierbarkeit. Er ist im hohen Maße von der
Korngrößenzusammensetzung des Oberbodens abhängig und läßt
sich vereinfacht in Abhängigkeit vom Schluffanteil
quantifizieren:
K=(0.0272926*Schluffgehalt)0.67933.
Bei Kenntnis der Hangneigung, der
Hanglänge und der Erosivität der lokalen Niederschlagssituation
(R-Faktor) kann unter Verwendung des K-Faktors der potentielle
langjährige Bodenabtrag durch Wassererosion abgeschätzt werden.
Tabelle 10: Erodierbarkeit von Böden durch
Wasser in Abhängigkeit von der Bodenart , Quelle: Tab. 79, KA4
| Kurzbezeichnung |
Bezeichnung |
K-Faktor |
| Eb1 |
sehr gering |
< 0,1 |
| Eb2 |
gering |
0,1- 0,2 |
| Eb3 |
mittel |
0,2 - 0,3 |
| Eb4 |
hoch |
0,3 -0,5 |
| Eb5 |
sehr hoch |
>0,5 |
Abkürzungen: Eb1 = Erodierbarkeitsklasse,
K-Faktor= Faktor zur Beschreibung der Empfindlichkeit von Böden
gegenüber Erosion
Tabelle 11: Einstufung der Erosionsgefährdung
berechnet als mittlerer langjähriger Bodenabtrag nach der
allgemeinen Bodenabtragsgleichung (A=R*K*LS*C).
| Kurzbezeichnung |
Bezeichnung |
Abtrag in
t/ha/a1) |
| EW1 |
sehr gering |
< 0.5 t |
| EW2 |
gering |
0.5 - 2.5 t |
| EW3 |
mittel |
2.5 - 7.5 t |
| EW4 |
hoch |
7.5 - 15 t |
| EW5 |
sehr hoch |
> 15 t |
Abkürzungen: t/ha/a = Tonnen pro ha und Jahr
EW1 = Erosionsgefährdungsklasse
1)Die Klassengrenzen beziehen sich auf
Standortverhältnisse, wie sie im norddeutschen Flachland
vorzufinden sind und sollte nicht ohne Überprüfung für andere
Gebiete angewendet werden.
Neben der Erosionsanfälligkeit
von Böden sollten grundsätzlich auch die Aspekte
'Verdichtungsanfälligkeit' und 'Verschlämmungsneigung' in die
Beurteilung der Schutzbedürftigkeit mit einfließen. Diese
Kriterien finden im vorliegenden Bewertungsschema noch keine
Berücksichtigung.
Integrierte funktionsbezogene Bewertung
Es ist davon auszugehen, daß
konkurrierende Ansprüche an die Nutzung von Böden bestehen. Wie
weiter oben ausgeführt, sind Böden hinsichtlich ihrer
Funktionsfähigkeit unterschiedlich einzustufen. Im Rahmen der
Landschaftsplanung sollen Räume entsprechend ihrer
unterschiedlichen Funktionspotentiale voneinander abgegrenzt
werden. Um diese Potentiale zur Bewertung der Funktionsfähigkeit
und Nutzungseignung beschreiben zu können, lassen sich
bodenkundliche Kennwerte als Indikatorgrößen verwenden (s.
Kapitel 2). Um zu einer die verschiedenen Bodenfunktionen
integrierenden Bewertung zu kommen, sind 3 Einstufungsschritte
vorzunehmen:
- Zuordnung von Funktionspotentialen in
Form von Bewertungszahlen auf der Grundlage
bodenkundlicher Kenngrößen (s. Tabelle 10 - 14).
Aus den Daten der Bodenschätzung lassen sich
Einstufungen zur Feldkapazität, nutzbaren
Feldkapazität, Luftkapazität, Wasserleitfähigkeit
gesättigter Böden, Kationenaustauschkapazität und zur
Verlagerung von Nitrat ableiten. Entsprechende
Bewertungszahlen lassen sich bodenbezogen der Lebensraum-
und Regelungsfunktion für den Landschaftswasserhaushalt
und der Regelungsfunktion für den
Landschaftsstoffhaushalt sowie der Produktionsfunktion
zuordnen.
- Abwägung ob das Risiko einer
Totalzerstörung oder einer irreversiblen
Beeinträchtigung des Bodens und damit eine besondere
Schutzbedürftigkeit besteht (in Tabelle 15 enthalten).
Hiervon ist grundsätzlich bei Moorböden und Gleyböden
auszugehen. Darüber hinaus besteht eine solche
Schutzbedürftigkeit für Böden, die durch ein hohes
Erosionsrisiko gekennzeichnet sind.
- Zusammenfassende funktionsbezogene
Bewertung (Tabellen 15 und 16). Es sollen die
Bodenfunktionen durch eine in Relation zu den anderen
Funktionen hohe Bewertungszahl gekennzeichnet werden,
für die der Boden von hoher Bedeutung ist. Als Resultat
ergibt sich eine Alternativentscheidung zugunsten der
Lebensraum- oder Produktionsfunktion, wobei die Bedeutung
der Lebensraumfunktion dann höher eingestuft wird, wenn
es sich um Böden mit besonders hohen oder besonders
niedrigen Kennwerten handelt. Dies ergibt sich aus der
Anforderung, einer Nivellierung von Lebensraumbedingungen
vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken. Die Entscheidung, ob
der zu bewertende Boden eine große Bedeutung für den
Natur- und Landschaftshaushalt in Hinblick auf seine
Regelungsfunktionen hat, ist grundsätzlich nicht davon
abhängig, ob die Lebensraum- oder die
Produktionsfunktion als prioritär eingestuft wird. Es
ist zu beachten, daß Standorte mit hohem
Regelungspotential für den Wasser- und Stoffhaushalt der
Landschaft eventuell zur Aufrechterhaltung ihrer
Funktionsfähigkeit mit Nutzungseinschränkungen zu
belegen sind; dies auch dann, wenn für die Böden ein
hohes Produktionspotential ausgewiesen wurde.
Tabelle 12: Indikatorgrößen und
Bewertungszahlen zur Charakterisierung des Wasserhaushalts, des
Nährstoffhaushalts sowie der Schutzbedürftigkeit von Standorten
.
| FK |
n.F.K. |
LK |
kf-Wert |
KAK |
NitratReten-tion |
Erosion |
sonstige Merkmale
|
aktueller
Nutzungstyp |
| FK1 |
nFK1 |
LK1 |
kf1 |
KAK1 |
NR1 |
EW1 |
Flurabstand
< 1m |
Wald,
Brache |
| FK2 |
nFK2 |
LK2 |
kf2 |
KAK2 |
NR2 |
EW2 |
Flurabstand
1-2m |
Grünland |
| FK3 |
nFK3 |
LK3 |
kf3 |
KAK3 |
NR3 |
EW3 |
|
|
| FK4 |
nFK4 |
LK4 |
kf4 |
KAK4 |
NR4 |
EW4 |
Gley |
Acker |
| FK5 |
nFK5 |
LK5 |
kf5 kf6
|
KAK5 kak 6
|
NR5 |
EW5 |
Moor |
|
Abkürzungen: FK1 = Feldkapazitäts-Klasse
nFK1 = nutzbare Feldkapazitäts-Klasse
LK1 = Luftkapazitätsklasse
kf1 = Wasserleitfähigkeitsklasse
KAK1 = Kationenaustauschkapazitätsklasse
NR1 = Nitrat-Retentions-Klasse
EW1 = Erosions-Klasse (Erosion durch Wasser)
Für Beispielstandort zutreffende Kategorie
dunkel hinterlegt.
Bei der Einstufung der
Lebensraumfunktion wird vornehmlich der Aspekt der Vielfalt von
Lebensräumen herangezogen. Es sollen besonders solche
Standortbedingungen hoch bewertet werden, die vom
"Normaltypus" einer Agrarlandschaft abweichen. Diese
Standorte können ein Gegengewicht zu der allgemeinen
Standortnivellierung darstellen, wie sie durch Nähr-
stofffeinträge und
Meliorationsmaßnahmen landesweit stattgefunden hat und immer
noch stattfindet. Die Einstufung erfolgt unter Berücksichtigung
der Parameter nutzbare Feldkapazität (hohe Bewertung für
Trockenstandorte) und der effektiven Kationenaustauschkapazität
(hohe Bewertung für sorptionsschwache Standorte). Neben den
trockenen und nährstoffarmen Standorten werden Gleye,
Niedermoore und grundwassernahe Standorte hoch bewertet.
Weiterhin kann die Einbeziehung des aktuellen Nutzungstyps die
Einstufung beeinflußen.
Tabelle 13: Indikatorgrößen und Bewertung
ihrer Relevanz für die Lebensraumfunktion.
| n.F.K. |
BZ n.F.K.
|
KAK |
BZ KAK
|
sonstige Merkmale
|
BZ s.M.
|
aktueller
Nutzungstyp |
BZ a.N.
|
| nFK1 |
5,00
|
KAK1 |
5,00
|
Flurabstand
< 1m |
5,00
|
Wald,
Brache |
5,00
|
| nFK2 |
3,00
|
KAK2 |
3,00
|
Flurabstand
1-2m |
3,00
|
. |
|
| nFK3 |
|
KAK3 |
|
|
|
Grünland
allg. |
2,00
|
| nFK4 |
|
KAK4 |
|
Gley |
3,00
|
Acker |
0,00
|
| nFK5 |
|
KAK5/6 |
|
Moor |
5,00
|
|
-5,00
|
Abkürzungen: nFK1 = Klasse nutzbare
Feldkapazität
KAK1 = Klasse Kationenaustauschkapazität
BZ = Bewertungszahl
Die Einstufung der
Regelungsfunktion "Wasserhaushalt" orientiert sich im
wesentlichen an den bodenhydrologischen Kenngrößen
Felkapazität (0- 100 cm Bodentiefe), Luftkapazität des
Oberbodens und gesättigte Wasserleitfähigkeit des Oberbodens.
Damit wird das Infiltrationspotential und das
Wasserhaltevermögen nach Niederschlagsereignissen postiv
bewertet. Außerdem fließt der Grundwasserflurabstand und
gegebenenfalls die Nähe zu Oberflächengewässern in die
Bewertung mit ein.
Tabelle 14: Indikatorgrößen und Bewertung
ihrer Relevanz für die Regelungsfunktion (1.Wasserhaushalt)
| FK |
BZ FK
|
LK |
BZ LK
|
kf-Wert |
BZ kF-W.
|
sonstige Merkmale
|
BZ s.M.
|
| FK1 |
|
LK1 |
1,00
|
kf1 |
1,00
|
Flurabstand
< 1m |
5,00
|
| FK2 |
|
LK2 |
2,00
|
kf2 |
2,00
|
Flurabstand
1-2m |
|
| FK3 |
1,00
|
LK3 |
3,00
|
kf3 |
3,00
|
|
|
| FK4 |
2,00
|
LK4 |
4,00
|
kf4 |
4,00
|
Gley |
5,00
|
| FK5 |
3,00
|
LK5 |
5,00
|
kf5/6 |
5,00
|
Moor |
5,00
|
Abkürzungen: FK1 = Feldkapazitäts-Klasse
LK1 = Luftkapazitätsklasse
kf1 = Wasserleitfähigkeitsklasse
BZ = Bewertungszahl
Für die Regelungsfunktion
"Stoffhaushalt" werden die Kenngrößen "effektive
Austauschkapazität" und
"Nitrat-Retentionsvermögen" herangezogen. Während die
KAK das standörtliche Puffervermögen gegenüber Kationen (z.B.
Kalium, Magnesium, Schwermetalle) kennzeichnet, beschreibt das in
Abhängigkeit von der Feldkapazität und der abgeschätzten
Sickerwasserrate ermittelte Nitrat-Retentionspotential die
Fähigkeit des Bodens, die Sickergeschwindigkeit gelöster Stoffe
gering zu halten.
Tabelle 15: Indikatorgrößen und Bewertung
ihrer Relevanz für die Regelungsfunktion (2. Stoffhaushalt).
| KAK |
BZ KAK
|
Nitrat-Ret. |
BZ N.R.
|
sonstige Merkmale
|
BZ s.M.
|
aktueller
Nutzungstyp |
BZ a.N.
|
| KAK1 |
1,00
|
NR1 |
1,00
|
Flurabstand
< 1m |
5,00
|
|
|
| KAK2 |
2,00
|
NR2 |
2,00
|
Flurabstand
1-2m |
3,00
|
|
|
| KAK3 |
3,00
|
NR3 |
3,00
|
|
|
|
|
| KAK4 |
4,00
|
NR4 |
4,00
|
Gley |
|
|
|
| KAK5 |
5,00
|
NR5 |
5,00
|
Moor |
5,00
|
|
|
Abkürzungen: KAK1 = Klasse
Kationenaustauschkapazität
NR1 = Klasse Nitratretentionsvermögen
BZ = Bewertungszahl
Die Produktionsfunktion eines
Standortes hängt in erster Linie vom Bodenwasserhaushalt und vom
Nährstoffhaushalt ab. Diese Aspekte lassen sich durch die
Parameter "nutzbare Feldkapazität", "eff.
Kationenaustauschkapazität" und
"Nitrat-Retentionspotential" darstellen. Handelt es
sich um Standorte mit erhöhter Schutzbedürftigkeit (Erosion,
Niedermoor; geringer Flurabstand), so werden entsprechende
Abzüge bei der Einstufung vorgenommen. Im Unterschied zur
Einstufung der landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit, wie sie
durch die Bodenschätzung abgeschätzt wird, soll bei der hier
vorgenommenen Bewertung der Produktionsfunktion der Aspekt einer
nachhaltigen Nutzung - also einer langfristigen qualitativen
Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit- von besonderem Belang sein.
Aus diesem Grunde werden Standorte, die durch spezifische
Nutzungen langfristig degradiert werden (z. B. erosionsanfällige
Standorte, Niedermoore, Gleye) in ihrer Produktionsfunktion
niedriger bewertet, als Vergleichsstandorte ohne solche
Eigenschaften.
Tabelle 16: Indikatorgrößen und Bewertung
ihrer Relevanz für die Produktionsfunktion
| n.F.K. |
BZ nFK
|
kf-Wert |
BZ kFW
|
KAK |
BZ KAK
|
Nitrat-Ret. |
BZ N.R.
|
Erosion |
BZ Eros.
|
sonstige Merkmale
|
BZ s.M.
|
| nFKWe1 |
1,00
|
kf1 |
-3,00
|
KAK1 |
1,00
|
NR1 |
-5,00
|
EW1 |
|
Flurabst. < 1 m
|
-3,00
|
| nFKWe2 |
2,00
|
kf2 |
|
KAK2 |
2,00
|
NR2 |
-3,00
|
EW2 |
|
Flurabst.1-2m |
|
| nFKWe3 |
3,00
|
kf3 |
|
KAK3 |
3,00
|
NR3 |
1,00
|
EW3 |
|
|
|
| nFKWe4 |
4,00
|
kf4 |
|
KAK4 |
4,00
|
NR4 |
2
|
EW4 |
-4,00
|
Gley |
|
| nFKWe5 |
5,00
|
kf5/6 |
|
KAK5/6 |
5,00
|
NR5 |
3,00
|
EW5 |
-5,00
|
Moor |
-3,00
|
Abkürzungen: nFK1 = Klasse Nutzbare
Feldkapazität
kf1 = Klasse kF-Wert
NR1 = Klasse Nitrat-Retentionsvermögen
EW1 = Klasse Erosionsneigung (durch Wasser)
BZ = Bewertungszahl
Um vergleichbare Bewertungsskalen
für die einzelnen Funktionsbereiche zu erhalten, werden die
Summen der zugeordneten Bewertungszahlen einer fünfstufigen
Skala zugeordnet.
Tabelle 17: Wertebereich der zusammenfassenden
funktionsbezogenen Bewertungsskalen und Ergebnisse für einen
Beispielsstandort.
| |
Lebensraum-
funktion
|
Regelungsfunktion Wasserhaushalt
|
Regelungsfunktion Nährstoffhaushalt
|
Produktions-
funktion
|
Schutzbedürftigkeit
Erosion Gley, Moor
|
absoluter Wertebereich
|
0 - 17
|
3 - 18
|
2 - 131
|
0 - 12
|
1 - 5
|
0 / 1
|
relativer Wertebereich
|
1 - 5
|
1 - 5
|
1 - 5
|
1 - 5
|
1 - 5
|
0 / 1
|
Ergebnis f.d.Beispiel
|
3,00
|
3,00
|
1,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
Eine verbale Abstufung der
funktionsbezogenen Bewertungen ist nicht unproblematisch, da
naturgemäß die Beschreibung "ohne Bedeutung" den
Funktionsbereichen nicht zugeordnet werden kann. Die folgende
Tabelle stellt den Versuch dar, den einzelnen Bewertungsstufen
eine verbale Beschreibung zuzuordnen.
Tabelle 18: Mögliche Interpretation der
funktionsbezogenen Bewertungszahlen.
Wertebereich
|
Einstufung
der Bedeutung für einzelne Funktionsbereche |
1,00
|
von
untergeordneter Bedeutung |
2,00
|
von Bedeutung |
3,00
|
von großer
Bedeutung |
4,00
|
von sehr
großer Bedeutung |
5,00
|
von
außerordentlicher Bedeutung |
Möglichkeiten der
Ergebnisdarstellung
Mit den dargestellten
Auswertungsschritten liefert das Programm BOSSA-SH eine Reihe
wesentlicher, für die flächenhafte Bodenbewertung grundlegender
Informationen. An dieser Stelle soll allerdings auch noch einmal
nachdrücklich auf die Möglichkeit von Fehl- und
Überinterpretationen hingewiesen werden. Diese sind insbesondere
dann möglich, wenn sich die Bodensituation seit der
Erstschätzung im erheblichen Maße geändert hat, eine
Nachschätzung aber nicht erfolgt ist. Erhebliche Veränderungen
können sich ergeben, wenn Bodenauftrag oder Bodenaushub
durchgeführt wurde, wenn Bodenabtrag durch Erosion im hohen
Maße stattgefunden hat oder eine erhöhte Mineralisation von
Torf zu verzeichnen ist. Ansonsten bleibt die prinzipielle
Erscheinungsform unserer Böden (insbesondere der Mineralböden)
in Zeiträumen von Jahrzehnten relativ stabil. Verändern können
sich selbstverständlich Größen wie die Schadstoffbelastung,
der Gehalt an Nährstoffen und einzelne Parameter wie
beispielsweise der pH-Wert. Hieraus folgt, daß eine auf den
Informationen der Bodenschätzung basierende funktionelle
Einstufung vorwiegend Potentiale abschätzt. Der aktuelle durch
die Nutzungseinflüsse des Menschen geprägte Zustand des Bodens
ist - soweit möglich - dieser Potentialabschätzung
gegenüberzustellen.
Im einzelnen sollte die
Ergebnisdarstellung einen Überblick über unterschiedliche
räumliche Bereiche entsprechend einer graduellen Abstufung von
Schutzwürdigkeit und der Schutzbedürftigkeit einzelner Böden
liefern. Dabei ergibt sich der Grad der Schutzwürdigkeit in
Abhängigkeit von der funktionsbezogenen Einstufung entsprechend
der Tabellen 10 bis 15. Eine erhöhte Schutzbedürftigkeit im
Sinne einer Empfindlichkeit gegenüber schädigenden bzw.
zerstörenden Einflüssen ist auf der Grundlage der abgeleiteten
Kenngrößen dann auszuweisen, wenn es sich um Böden mit hoher
Erosionsneigung handelt oder wenn es sich um Niedermoorböden
oder Gleye handelt.
Bei der flächenhaften Darstellung
der Sachverhalte wäre im Rahmen des Grundlagenteils eines
Landschaftsplanes die Erstellung von 3 Karten empfehlenswert:
- Karte zur Kennzeichnung von
Flächen mit hoher Schutzwürdigkeit aufgrund ihrer
Lebensraum- und Produktionsfunktion.
- Karte zur Kennzeichnung von
Flächen mit hoher Schutzwürdigkeit aufgrund ihrer
Regelungsfunkion für den Landschaftswasser- und
Stoffhaushalt.
- Karte zur Kennzeichnung von
Flächen mit hoher Schutzbedürftigkeit.
Zusätzlich sollte die gesonderte
Darstellung des Nitratretentionsvermögens von Böden erwogen
werden, da gerade dieser Parameter für die Landbewirtschaftung
von besonderem Interesse ist und somit eine wichtige
Entscheidungshilfe für den Landwirt darstellen kann. Für den
Bereich von Trinkwasserschutzgebieten dürfte die Erstellung
einer solchen Karte ohnehin in naher Zukunft obligatorisch sein.
Wird mit digitalen Karten
gearbeitet und liegen auch digitale Karten zur Realnutzung vor,
so ist die Darstellung von Konfliktbereichen (Flächen deren
Nutzung den Erfordernissen gemäß Schutzwürdigkeit und
-bedürftigkeit nicht entspricht) unproblematisch und für eine
Situa-
tionsbewertung sehr
aufschlußreich. Für die Erstellung der genannten Karten sind
eine Reihe zusätzlicher Daten und Methoden notwendig, deren
Beschreibung nicht Gegenstand der vorliegenden
Programmbeschreibung sein kann. Dennoch soll in wenigen Sätzen
darüber berichtet werden, welche Erfahrungen zum Thema "
Verarbeitung bodenbezogener Raumdaten" vorliegen:
Wie weiter oben beschrieben, ergibt sich für
die Grablochbeschreibungen der Bodenschätzung der Raumbezug aus
den sogenannten Schätzkarten, wie sie bei den Finanzämtern
vorliegen bzw. aus den sogenannten Schätzpausen, wie sie von
Katasterämtern zur Verfügung gestellt werden. Diese Karten
wurden häufig im Maßstab 1:2000 hergestellt, also angepaßt an
die Flurkarten, sie können aber auch in einem größeren
Maßstab (1:500) bzw. kleineren (1:5000) vorliegen bzw.
übetragen worden sein. Da Flurkarten und damit auch
Schätzkarten auf einem für die Weiterverarbeitung ungünstigen
Projektionsmodus (Söldner Projektion) basieren, sollte eine
Übertragung von Schätzgrenzen und Grablochpositionen in die
Geometrien der Deutschen Grundarte 1:5000 erfolgen. Wird mit
digitalen Karten gearbeitet, so ist als Übertragungsgrundlage
ein Ausdruck der ATKIS-Geometrien (wird vom Landesvermessungsamt
Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt) zu wählen. Es sollte
betont werden, daß nur durch die Verwendung von ATKIS-Geometrien
die Möglichkeit einer durchgängig unproblematischen
Weiterverwendbarkeit der erstellten digitalen Karten über das
konkrete durchzuführende Planungsvorhaben hinaus gegeben ist.
Liegt eine digitale Polygonkarte mit den Klassengrenzen der
Bodenschätzung vor, so sollte einzelnen Polygonen eine zu
vergebende laufende Nummer (entspricht dem Feld "lfdnr"
in der Eingabemaske) zugeordnet werden. Über diese Kennummer
können dann alle kartographisch darzustellenden Variablen aus
der Resultatdatei von BOSSA-SH an das Variablenverzeichnis der
Karte angehängt werden. Das Programm ARC-INFO bzw. ARC-VIEW
übernimmt beispielsweise direkt Daten der im DBF -Format
vorliegenden Dateien. Nicht selten liegen mehrere Grablöcher der
Bodenschätzung in einer Klassenfläche. Es handelt sich dann in
der Regel um ein "bestimmendes Grabloch" und um
benachbarte "nicht bestimmende Grablöcher". Weichen
die "nicht bestimmenden Grablöcher" in ihrer
Bodenbeschreibung erheblich von der des "bestimmenden
Grabloches" ab, so sollte eine zusätzliche reliefbezogene
Abgrenzung innerhalb einer Klassengrenze ausgewiesen werden.
Zitierte bzw. weiterführende Literatur zum
Thema Bodenschätzungsauswertung
Benne, I., Heineke H.-J. & Nettelmann R.
(1990): Die DV-gestützte Auswertung der Bodenschätzung-
Erfassungsanweisung und Übersetzungsschlüssel. In:
Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (Hrsg.):
Technische Berichte zum NIBIS (Bodenkunde), Scchweitzerbart'sche
Verlagsbuchhandlung, Hannover, 30-61.
Cordsen, E. (1993): Böden des Kieler Raumes.
Untersuchungen der Böden natürlicher Lithogenese unter
Verwendung EDV-gestützt ausgewerteter Daten der
Bodenschätzung.. Schriftenr. Institut f. Pflanzenernährung u.
Bodenkunde Universität Kiel (Bd. 25, S. 1 - 255).
Kaske, A. (1996): Vergleich einer auf Basis der
Bodenschätzung erstellten Konzeptbodenkarte mit einer
Catenenkartierung gemäß bodenkundlicher Kartieranleitung KA3.
Diplomarbeit, Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde,
Christian-Albrecht Universität.
Göbel , B (1997): Messung und Modellierung des
flächenhaften Wasser- und Stofftransports aus landwirtschaftlich
genutzten Flächen auf zwei Maßstabsebenen unter besonderer
Berücksichtigung der Bereitstellung bodenkundlicher Daten für
die Modellrechnung. ECOSYS Suppl.Bd 19 (1 - 135).
REICHE, E.-W. (1991): Entwicklung, Validierung
und Anwendung eines Modellsystems zur Beschreibung und
flächenhaften Bilanzierung der Wasser- und Stickstoffdynamik in
Böden. Kieler Geographische Schriften (79).
Reiche, E.-W. & Schleuss, U. (1992):
Untersuchungen zur Aussagegenauigkeit von Daten der
Bodenschätzung anhand der Ergebnisse einer aktuell
durchgeführten Bodenkartierung mit Hilfe eines Geographischen
Informationssystems (GIS). Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl.
Gesellsch. 67, 249-252.
Schleuss, U. & Reiche, E.-W. (1994):
Verwaltung und Auswertung von Bodendaten mittels GIS, Modellen
und Datenbank im Projektzentrum Ökosystemforschung. - In: ESRI
(eds.): Arcinfo, 2. Deutsche Anwenderkonferenz, Tagungsband, 152-
160.
Erklärungen zur Datei Bossdat (ausführliche Ergebnisdatei von BOSSA-SH)
Anhang 1
Datensatzstruktur der Datei "BOSSDAT-DBF" (diese Datei enthält alle horizontspezifischen Detailinformationen und wird bei jeder neuen BOSSA-Anwendung überschrieben)
|
FIELD_NAME |
FIELD_TYPE |
FIELD_LEN |
FIELD_DEC |
BEDEUTUNG |
|
LFDNR |
N |
5 |
0 |
laufende Nummer |
|
FINANZAMT |
N |
4 |
0 |
Finanzamtsnummer |
|
FINANZANAM |
C |
12 |
0 |
Finanzamtsname |
|
GEMEINDE |
C |
30 |
0 |
Gemeinde |
|
GEMEINDENR |
N |
6 |
0 |
Gemeindekennzahl |
|
GEMARKUNG |
C |
30 |
0 |
Gemarkung |
|
GEMARKNR |
N |
3 |
0 |
Gmarkungs-Kennzahl |
|
FLUR |
N |
4 |
1 |
Flur-Nummer |
|
TAGESABSCH |
N |
2 |
0 |
Tagesabschnittsnummer |
|
DATUM |
D |
8 |
0 |
Datum der Aufnahme |
|
NACHSCHATZ |
C |
14 |
0 |
Datum der Nachschätzung |
|
NACHTRAG |
C |
14 |
0 |
Nachträge |
|
NRGRABLOCH |
C |
10 |
0 |
Grablochnummer |
|
BESTGRABLO |
C |
10 |
0 |
Nummer des best. Grablochs |
|
KULTURART |
C |
5 |
0 |
Kulturart |
|
KLASSE |
C |
17 |
0 |
Klassen Zeichen |
|
ZAHL1 |
N |
2 |
0 |
Acker/Grünlandgrundzahl |
|
ZAHL2 |
N |
2 |
0 |
|
|
BODENZAHL |
N |
2 |
0 |
Bodenzahl |
|
ABODENGEF |
C |
30 |
0 |
Horizont Menrkmale 1. Horizont |
|
BBODENGEF |
C |
30 |
0 |
Horizont Menrkmale 2 Horizont |
|
CBODENGEF |
C |
30 |
0 |
Horizont Menrkmale 3 Horizont |
|
DBODENGEF |
C |
30 |
0 |
Horizont Menrkmale 4 Horizont |
|
ABODENGEF2 |
C |
30 |
0 |
Felder für Nachschätzung |
|
BBODENGEF2 |
C |
30 |
0 |
" |
|
CBODENGEF2 |
C |
30 |
0 |
" |
|
DBODENGEF2 |
C |
30 |
0 |
" |
|
ABODENGEF3 |
C |
30 |
0 |
" |
|
BBODENGEF3 |
C |
30 |
0 |
" |
|
CBODENGEF3 |
C |
30 |
0 |
" |
|
DBODENGEF3 |
C |
30 |
0 |
" |
|
BESOND |
C |
30 |
0 |
Besonderheiten |
|
ERGAENZUNG |
C |
30 |
0 |
Ergänzungen |
|
NR |
N |
3 |
0 |
|
|
BLATT |
C |
20 |
0 |
Name d. betr. Kartenblattes |
|
KRECHT |
N |
6 |
0 |
Rechtswert (Koordinate) |
|
KHOCH |
N |
6 |
0 |
Hochwert (Koordinate) |
|
NEIG |
N |
4 |
0 |
Hangneigung |
|
HLAENG |
N |
4 |
0 |
Hanglaenge |
|
GRUWA |
N |
5 |
1 |
Gundwasser-Flurabstand |
|
NOMEAN |
C |
48 |
0 |
internes Feld |
|
NOMEAN2 |
C |
48 |
0 |
Internes Feld |
|
ASUBS |
C |
9 |
0 |
Bodenart 1. Horiz. |
|
BSUBS |
C |
9 |
0 |
Bodenart 2. Horiz. |
|
CSUBS |
C |
9 |
0 |
Bodenart 3. Horiz. |
|
DSUBS |
C |
9 |
0 |
Bodenart 4. Horiz. |
|
AHOR |
C |
14 |
0 |
Horizontbezeichnung 1. |
|
BHOR |
C |
14 |
0 |
Horizontbezeichnung 2. |
|
CHOR |
C |
14 |
0 |
Horizontbezeichnung 3. |
|
DHOR |
C |
14 |
0 |
Horizontbezeichnung 4. |
|
TYP |
C |
16 |
0 |
Bodentyp |
|
ATIEFE |
N |
3 |
0 |
Horizontmächtigkeit 1. |
|
BTIEFE |
N |
3 |
0 |
Horizontmächtigkeit 2. |
|
CTIEFE |
N |
3 |
0 |
Horizontmächtigkeit 3. |
|
DTIEFE |
N |
3 |
0 |
Horizontmächtigkeit 4. |
|
AHUM |
C |
10 |
0 |
Humusklasse 1 |
|
BHUM |
C |
10 |
0 |
Humusklasse 2 |
|
CHUM |
C |
10 |
0 |
Humusklasse 3 |
|
DHUM |
C |
10 |
0 |
Humusklasse 4 |
|
ASKEL |
C |
5 |
0 |
Skelett Anteil 1 |
|
BSKEL |
C |
5 |
0 |
Skelett Anteil 2 |
|
CSKEL |
C |
5 |
0 |
Skelett Anteil 3 |
|
DSKEL |
C |
5 |
0 |
Skelett Anteil 4 |
|
AKALK |
N |
3 |
0 |
Kalk-Gehalt 1 |
|
BKALK |
N |
3 |
0 |
Kalk-Gehalt 2 |
|
CKALK |
N |
3 |
0 |
Kalk-Gehalt 3 |
|
DKALK |
N |
3 |
0 |
Kalk-Gehalt 4 |
|
ATORF |
C |
9 |
0 |
Torf-Bez. 1 |
|
BTORF |
C |
9 |
0 |
Torf-Bez. 2 |
|
CTORF |
C |
9 |
0 |
Torf-Bez. 3 |
|
DTORF |
C |
9 |
0 |
Torf-Bez. 4 |
|
AZER |
N |
2 |
0 |
Zersetzungsgrad 1 |
|
BZER |
N |
2 |
0 |
Zersetzungsgrad 2 |
|
CZER |
N |
2 |
0 |
Zersetzungsgrad 3 |
|
DZER |
N |
2 |
0 |
Zersetzungsgrad 4 |
|
AFARB |
C |
6 |
0 |
farbliche Kennzeichen 1 |
|
BFARB |
C |
6 |
0 |
farbliche Kennzeichen 2 |
|
CFARB |
C |
6 |
0 |
farbliche Kennzeichen 3 |
|
DFARB |
C |
6 |
0 |
farbliche Kennzeichen 4 |
|
AEIS |
C |
7 |
0 |
Eisen-Stufe 1 |
|
BEIS |
C |
7 |
0 |
Eisen-Stufe 2 |
|
CEIS |
C |
7 |
0 |
Eisen-Stufe 3 |
|
DEIS |
C |
7 |
0 |
Eisen-Stufe 4 |
|
ACORG |
N |
6 |
1 |
Humusgehalt in % 1. Horiz. |
|
BCORG |
N |
6 |
1 |
Humusgehalt in % 2. Horiz. |
|
CCORG |
N |
6 |
1 |
Humusgehalt in % 3. Horiz. |
|
DCORG |
N |
6 |
1 |
Humusgehalt in % 4. Horiz. |
|
ATON |
N |
5 |
1 |
Tongehalt in % 1. Horizont |
|
BTON |
N |
5 |
1 |
Tongehalt in % 2. Horizont |
|
CTON |
N |
5 |
1 |
Tongehalt in % 3. Horizont |
|
DTON |
N |
5 |
1 |
Tongehalt in % 4. Horizont |
|
ASCHLU |
N |
5 |
1 |
Schluffgehalt in % 1. Horizont |
|
BSCHLU |
N |
5 |
1 |
Schluffgehalt in % 2. Horizont |
|
CSCHLU |
N |
5 |
1 |
Schluffgehalt in % 3. Horizont |
|
DSCHLU |
N |
5 |
1 |
Schluffgehalt in % 4. Horizont |
|
ADICHTE |
N |
5 |
2 |
Lagerungsdichte 1. Horiz. |
|
BDICHTE |
N |
5 |
2 |
Lagerungsdichte 2. Horiz. |
|
CDICHTE |
N |
5 |
2 |
Lagerungsdichte 3. Horiz. |
|
DDICHTE |
N |
5 |
2 |
Lagerungsdichte 4. Horiz. |
|
AKF |
N |
8 |
3 |
KF-Wert 1. Horiz. |
|
BKF |
N |
8 |
3 |
KF-Wert 2. Horiz. |
|
CKF |
N |
8 |
3 |
KF-Wert 3. Horiz. |
|
DKF |
N |
8 |
3 |
KF-Wert 4. Horiz. |
|
EDWE |
N |
5 |
1 |
potentielle Durchwurzelbarkeit |
|
APF0 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 0 1. Horiz. |
|
BPF0 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 0 2. Horiz. |
|
CPF0 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 0 3. Horiz. |
|
DPF0 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 0 4. Horiz. |
|
APF18 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 1,8 1. Hori |
|
BPF18 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 1,8 2. Hori |
|
CPF18 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 1,8 3. Hori |
|
DPF18 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 1,8 4. Hori |
|
APF42 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 4,2 1. Hori |
|
BPF42 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 4,2. 2. Hor |
|
CPF42 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 4,2 3. Hori |
|
DPF42 |
N |
5 |
1 |
Wassergehalt b. pF 4,2 4. Hori |
|
GEFELD |
N |
5 |
1 |
Gesamtfeldkapaz. (0-100 cm) |
|
LEG1 |
N |
3 |
0 |
Legend.Nr. f. Bodentypenkarte |
|
LEG2 |
N |
3 |
0 |
Legend.Nr. f. Bodenartenkarte |
|
SICKWA |
N |
5 |
1 |
mittl. järhl. Sickerwassermeng |
|
AUSTRAG |
N |
5 |
1 |
Nitrat-Austrag in % |
|
KONZ |
N |
5 |
1 |
Nitrat-Konz. im Sickerwasser |
|
BWLEB |
N |
5 |
2 |
Bewert.Zahl Lebensraumfunkt. |
|
BWREGW |
N |
5 |
2 |
Bew.Z. Regel.Funktion Wasser |
|
BWREGS |
N |
5 |
2 |
Bew.Z. Regel.Funktion Stoff |
|
BWPRO |
N |
5 |
2 |
Bew.Z. Produktionsfunktion |
|
APH |
N |
3 |
1 |
eingesetzte pH-Wert 1. Horiz. |
|
BPH |
N |
3 |
1 |
eingesetzte pH-Wert 2. Horiz. |
|
CPH |
N |
3 |
1 |
eingesetzte pH-Wert 3. Horiz. |
|
DPH |
N |
3 |
1 |
eingesetzte pH-Wert 4. Horiz. |
|
HBODART |
C |
10 |
0 |
Hauptbodenart |
|
HNUTZ |
C |
10 |
0 |
Nutzung |
|
KAKE |
N |
4 |
0 |
effkt. KAK |
|
LUFTK |
N |
4 |
0 |
Luftkapazität |
|
NFK |
N |
4 |
0 |
nutzbare Feldkap. |
|
NRETENT |
N |
4 |
0 |
N-Retentionsvermögen |
|
SONDS |
C |
10 |
0 |
|
|
EROS |
N |
4 |
0 |
Erosionsneigung (St. 1 - 5) |
|
FUNKWAS |
N |
4 |
0 |
Funktionsbewet. Wasserhaush. |
|
FUNKSTO |
N |
4 |
0 |
Funktionsbewertung Stoffhaush. |
|
FUNKLEB |
N |
4 |
0 |
Funktionsbewert. Lebensraum |
|
FUNKPRO |
N |
4 |
0 |
Funktionbewert. Produktion |
|
KAKBW |
N |
2 |
0 |
KAK eff. Bewertungszahl |
|
BWLK |
N |
2 |
0 |
Luftkapazität Bewertungszahl |
|
BWNFK |
N |
2 |
0 |
nutzbare Feldkapaz. Bew.zahl |
|
BWNIT |
N |
2 |
0 |
N-Austrag-Bewertungszahl |
|
BWFK |
N |
2 |
0 |
Gesamtfeldkap. Bewertungszahl |
|
BWKF |
N |
2 |
0 |
KF-Bewertungstzahl |