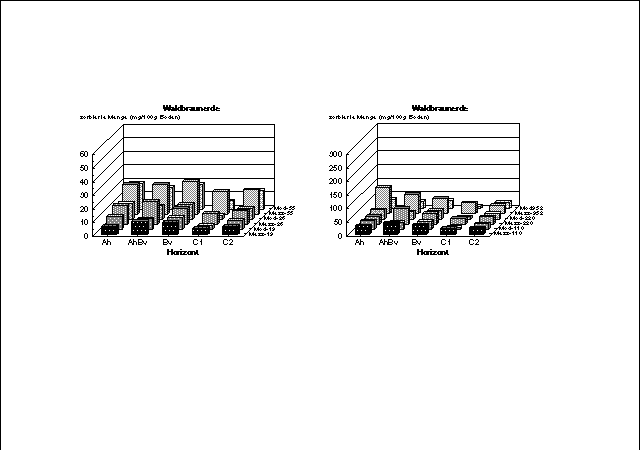
Im Rahmen dieser Untersuchung konnten aus arbeits- und zeittechnischen Gründen keine empirischen Daten zum Sorptionsverhalten der Böden des Untersuchungsgebietes gewonnen werden. Dies hätte bei der Größe und Heterogenität des Gebietes den Umfang der Arbeit gesprengt. Es war daher das Ziel, einen Beitrag zur methodischen Analyse und Auswertung des bestehenden Datenpools zu liefern und mit den vorhanden und ableitbaren Daten eine räumliche Aussage zu treffen, auch wenn die Ergebnisse unschärfer sein sollten als diejenigen, die durch ein großes Meßprogramm gewonnen werden könnten.
BIRKHOLZ (1991) untersuchte die räumliche und zeitliche P-Verteilung in repräsentativen Böden des Schwerpunktraumes. Im Projekt sind allerdings keine Daten in Schüttelversuchen erhoben worden, wodurch sich die Frage ergibt, wie ein geeignetes Phosphatsorptionsmodell ohne diese Daten zu erstellen ist. Zur Lösung des Problems boten sich zwei Vorgehensweisen an:
Die Anpassung der Sorptionsdaten von KUHNT (1987) an Phosphatad- und -desorptionsmodelle ist unproblematisch (s. Abb. 6-1). Allerdings steht einer flächenhaften Extrapolation und Adaption dieser Isothermen die Frage der Übertragbarkeit der Daten auf die Böden des Untersuchungsgebietes im Wege. Das Spektrum, der im Einzugsgebiet der Bornhöveder Seenkette vorkommenden Bodenformen, ist nicht durch sechs exemplarisch untersuchte Böden abzudecken. Methodisch ist der šbernahme und Weiterentwicklung von PTF, welche die Sorptionskennwerte durch Bodenparameter abschätzen, der Vorzug zu geben, zumal die angesprochenen PTF von SCHEINOST (1995) die Steuergrößen der Phosphatsorption wie die Gehalte an Eisen, Ton und organischer Substanz beinhalten. Die Verwendung der PTF ermöglicht die Berücksichtigung der bodengenetisch differenzierten und räumlich stark variierenden Bodenparameter des Untersuchungsgebiets. Die Kalibrierung der PTF für Bodenformen Schleswig-Holsteins kann durch die Sorptionsdaten von KUHNT (1987) erfolgen.
SCHEINOST (1995) hat in seiner Untersuchung für bayerische Bodenformen drei Sorptionsmodelle in ihrer Anpassung getestet und gefittet: FREUNDLICH-, LANGMUIR- und TEMKIN-Isothermen. Die Sorptionsdaten stammen aus Schüttelversuchen, in denen acht Meßwerte je Boden bei Ausgangskonzentrationen von 0 bis 9.6 mg P/l bestimmt wurden. Da "die TEMKIN-Gleichung am geeignetsten ist, um Sorptionskurven sehr unterschiedlicher Böden mit unterschiedlichen PO4-Sättigungen einheitlich zu parametrisieren" (SCHEINOST 1995, S. 96), wurden für diese Gleichung die Parameter durch Pedotransferfunktionen (PTF) abgeschätzt. Der Gültigkeitsbereich der PTF ist streng genommen auf den verwendeten Konzentrationsbereich von 0 - 9.6 mg P/l und auf Böden mit den Charakteristika, wie sie die untersuchten Böden aufweisen, eingeschränkt. Mit pH-Werten von 5.5 - 7, Tongehalten von 10 - 30% und CORG-Anteilen von 0 - 20% reichen die untersuchten Bodenformen nicht aus, um das Spektrum der Bodenkenngrößen im Gebiet der Bornhöveder Seenkette zu repräsentieren. Es fehlen insbesondere Böden mit niedrigeren pH-Werten und geringeren Tongehalten. Zugleich sind als Vergleichswerte nur Daten aus Schüttelversuchen mit recht hohen Ausgangskonzentrationen von 13.2 - 352 mg P/l vorhanden, die ebenfalls außerhalb des Gültigkeitsbereiches der PTF liegen. Somit stellt sich als zusätzliche Frage die der Anwendbarkeit der PTF außerhalb ihres Gültigkeitsbereiches.
Sorptionsmodell und PTF
Die vereinfachte Form der TEMKIN-Gleichung (Gl. 6-1) ist in der Lage, negative Sorptionswerte (d.h. Desorption) zu beschreiben. Wenn Pl Werte kleiner als Pl0 annimmt, dann wird Ps negativ.
mit: Ps sorbierte Menge [mg/kg]
Pmax maximale Sorptionskapazität [mg/kg]
Pl Konzentration der Gleichgewichtslösung [mg/l]
Plo aktuelle Bodenlösungskonzentration [mg/l]
T absolute Temperatur [K]
R allgemeine Gaskonstante [J/K*mol]
Die PTF, die zur Vorhersage von AT in dieser Arbeit eingesetzt wurde, benötigt die wenigsten Bodenparameter. Die Auswahl zugunsten dieser PTF ist durch den Datenbestand der flächenhaft vorliegenden Bodendaten notwendig geworden.
PTF AT
mit: b* (Blau-Gelbwert, s. Gl. 6-3)
Ton [%]
pH (CaCl2)
PCAL nach Calcium-Acetat-Lactat-Extraktion gelöstes P [g/kg]
nach b* aufgelöste PTF Fed
mit: Fed Dithionit-extrahierbares Fe [g/kg]
log Pl0= -2.4+2.3* r2=0.90, n=50 (6-4)
PTF Pl0
mit: Corg [%]
Zur Validierung der Ergebnisse wurden die durch die vorgestellten Pedotransferfunktionen in den Gleichungen 6-2 bis 6-4 vorhergesagten Sorptionskurven mit den ursprünglichen Meßdaten aufgetragen. Die Vorhersagegenauigkeit wird als ausreichend bezeichnet (SCHEINOST 1995).
Zur automatisierten Modellierung der Phosphatsorption und zur Überprüfung der PTF wurde von Dr. E.-W. REICHE ein dBASE-Programm geschrieben, daß die in dBASE eingegebenen Bodenparameter der untersuchten Böden von KUHNT (1987) einliest und mit den PTF in den Gleichungen 6-1 bis 6-4 die Phosphatsorptionswerte berechnet. Zur Kalibrierung des Modells werden diese Ergebnisse mit den von KUHNT (1987) gemessenen Sorptionswerten verglichen.
Folgende Probleme sind vor der Berechnung und dem Vergleich der Daten zu lösen:
Modellösung der besprochenen Datenmängel bzw. Probleme:
Der PCAL-Gehalt der Bodenprobe ist unbekannt. Daher wird er im Modell im ersten Simulationsjahr abgeschätzt. Je nach Nutzung und Profiltiefe werden den Bodenproben PCAL-Werte von 10-2 g/kg in Oberböden von Ackerflächen bis 10-6 g/kg in tieferen Horizonten ackerbaulich ungenutzter Böden als Schätzwert vorgegeben. Die zu Beginn einer Simulation bereits sorbierte Menge P (PSORB) wird der PCAL-Menge gleichgesetzt:
Nun startet im Modell eine Iteration, die endet, wenn die "potentiell" sorbierte Menge der aktuell sorbierten Menge PSORB entspricht. In diesem Fall ist das Gleichgewicht erreicht. Die Abbildung 6-2 zeigt schematisch die Iteration mit dem sich einstellenden Gleichgewicht.
Abb. 6-2: Schematische Darstellung zur Berechnung der Gleichgewichtskonzentration
Die P-Aufnahme durch die Vegetation und die irreversible Festlegung von P im Boden wird von der sorbierten Menge (PSORB) subtrahiert. So entsteht ein geschlossener P-Kreislauf im betrachteten Bodenkompartiment. In einem zweiten Simulationsjahr (erneute Zugabe von P) wird der PCAL-Wert nicht mehr abgeschätzt. Der PSORB-Endzustand des ersten Jahres wird als PCAL-Wert angenommen.
Das Modell berechnet zur Kalibrierung für alle von KUHNT (1987) geschüttelten Bodenproben ein Lösungsgleichgewicht und die Menge an sorbiertem P. Als Inputdaten für die Pedotransferfunktionen dienen die Bodenparameter von KUHNT (1987) (Tabelle s. Anhang).
Die Laborwerte von insgesamt 27 Bodenhorizonten aus sechs verschiedenen Bodenformen können nun mit den Modellwerten verglichen und interpretiert werden. Zunächst werden alle Sorptionsdaten von P2O5 in P umgerechnet (Faktor: 0.437) und auf 100 g Boden bezogen. Die Gleichgewichtskonzentration in mg P/l wird berechnet. Die Ausgangskonzentrationen der Schüttelversuche betrugen 13.2 - 26.4 - 55 - 110 - 220 - 352 mg P/l.
Bei der Betrachtung der Übereinstimmung zwischen Labor- und Meßwerten und der Beurteilung des P-Modells muß beachtet werden, daß unplausible Meßwerte ebenso zu einer Diskrepanz führen können wie Mängel des Sorptionsmodells.
Der Umstand, daß die pH-Werte der zu überprüfenden Horizonte niedriger sind, als jene für die die PTF entwickelt und kalibriert wurden, bewirkt, daß Böden mit geringem pH-Wert in ihrer Sorption stark überschätzt werden (s. Gl. 6-2). Dies gilt insbesondere für Böden, die gleichzeitig hohe Tongehalte aufweisen (Braunerde-Lessiv‚). Um diesen Einfluß zu verringern, wurde für Böden, bei denen hohe Tongehalte bei gleichzeitiger starker Versauerung indiziert werden, ein vorläufiger Korrekturfaktor (KF) in das P-Sorptionsmodell implementiert. Dadurch ergibt sich eine modifizierte Gleichung zur Vorhersage von AT:
mit: KF = 0 für pH > 4
KF = für pH < 4 oder Ton > 3*pH
In den unteren Konzentrationsbereichen (13 - 55 mg P/l) ist die Übereinstimmung bei vier von fünf Horizonten gut. Bei höheren Ausgangskonzentrationen wird die Sorptionskapazität in dem AhBv- und dem Bv-Horizont erheblich unterschätzt. Lediglich der C1-Horizont kann über die gesamte Konzentrationsspanne nicht genau bestimmt werden. Dies liegt an dem im Profilvergleich hohen pH-Wert von 7.1, der in der PTF und in dem Modell zu einer geringen Sorptionseinschätzung führt. In diesem Fall wird der pH-Einfluß im Modell überschätzt. Eine hypothetische Absenkung des pH-Wertes auf Profilniveau (4.1) führt zu einer wesentlich genaueren Wiedergabe der Meßwerte.
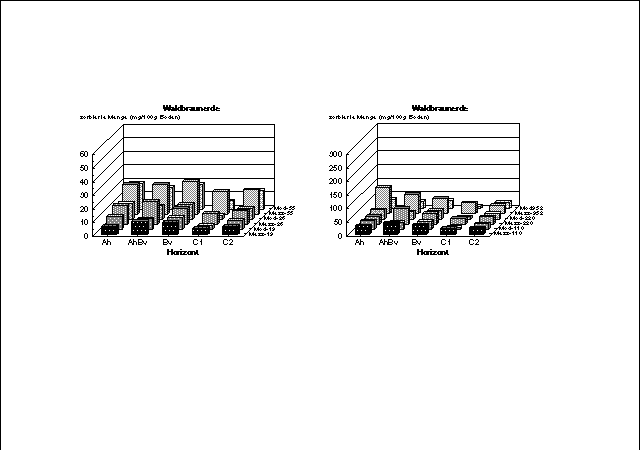
Schätzsicherheit des Hortisols
Die Sorption in dem RAh-Horizont des Hortisols kann sicher vorausgesagt werden. Der RAhBv- und der RC-Horizont werden niedriger geschätzt als sie gemessen wurden. Im RC-Horizont ist eine geringe Sorption plausibel, da weder Ton, noch nennenswerte Mengen an Eisen oder Corg-Gehalte diesen Boden prägen. Er ist auch in der Laboranalyse durch vergleichsweise niedrige Sorptionswerte gekennzeichnet. Im RAhBv-Horizont könnte der relativ hohe Alo-Gehalt von 2,00% die Diskrepanz zwischen Meß- und Modellwerten erklären, da Aluminium in der PTF keine Berücksichtigung findet.

Abb. 6-4: Gegenüberstellung der gemessenen Phosphatsorption mit den Modellwerten für die Horizonte des Hortisols (Mess13 = gemessene P-Sorption bei 13.2 mg P/l Aus- gangskonz., Mod13 = modellierte P-Sorption bei dieser Ausgangskonz.)
Schätzsicherheit des Braunerde-Kolluviums
Die Horizonte des Braunerde-Kolluviums werden alle bis zu einer Ausgangskonzentration von einschließlich 110 mg P/l gut geschätzt. In den höheren Konzentrationsbereichen werden sämtliche Horizonte unterschätzt.
Schätzsicherheit des Anmoorgleys
Der GoAa- und der Gor-Horizont des Anmoorgleys zeichnen sich beide durch eine hohe Sorptionsfähigkeit aus. Sie weisen hohe Gehalte an Fed und Corg auf. Der GoAa-Horizont enthält darüber hinaus überdurchschnittlich viel Ton (23%). Dieses Sorptionsverhalten kann nur im Gor-Horizont gut durch das Modell nachvollzogen werden. Hier wirkt sich der niedrige pH-Wert sorptionsfördernd im Modell aus. Der GoAa-Horizont wird erst nach einer Verringerung des PCAL-Gehaltes nicht mehr überschätzt. Der Gr-Horizont enthält weniger Ton, organische Substanz und Eisen. Die gemessene Sorption ist folglich wesentlich niedriger als bei den beiden anderen Horizonten. Allerdings wird diese geringe Sorption von dem Modell noch unterschätzt. Hierfür ist der pH-Wert von 7 verantwortlich, der eine "angemessene" P-Sorption verhindert.

Abb. 6-6: Gegenüberstellung der gemessenen Phosphatsorption mit den Modellwerten für die Horizonte des Anmoorgleys (Mess13 = gemessene P-Sorption bei 13.2 mg P/l Ausgangskonz., Mod13 = modellierte P-Sorption bei dieser Ausgangskonz.)
Schätzsicherheit des Braunerde-Lessivés
Mit Ausnahme des Ah-Horizontes ist in den Horizonten des Braunerde-Lessivés die Modellschätzung zu hoch. Dies liegt ganz eindeutig an den sehr niedrigen pH-Werten bei gleichzeitigen Tongehalten von 9 - 21% und Eisengehalten von 3.4 - 4.9%. Diese Überschätzung macht sich in den unteren Konzentrationsbereichen weniger bemerkbar, da dort die Labordaten ähnlich hoch liegen. Im Modell konnte bei einer hypothetischen pH-Erhöhung um zwei pH-Stufen die Genauigkeit der berechneten Sorptionswerte erheblich gesteigert werden. Der Ah-Horizont wird infolge seines zu hoch geschätzten PCAL-Anfangsgehaltes in seiner Sorptionsfähigkeit unterschätzt.

Abb. 6-7: Gegenüberstellung der gemessenen Phosphatsorption mit den Modellwerten für die Horizonte des Braunerde-Lessiv‚s (Mess13 = gemessene P-Sorption bei 13.2 mg P/l Ausgangskonz., Mod13 = modellierte P-Sorption bei dieser Ausgangskonz.)
Schätzsicherheit des Eisen-Humus-Podsols
Von den Horizonten des Eisen-Humus-Podsols fällt der Bh,fe-Horizont durch sein Sorptionsverhalten auf. Infolge seiner Bodenkenngrößen (Fed=4.6%, Ton=2.4%, Corg=15.4%) sind die Labormeßwerte nachvollziehbar. Diese hohe Sorptionsfähigkeit über die gesamte Konzentrationsspanne wird von dem Modell nur qualitativ nachvollzogen. Die Diskrepanz kann hier durch die Nichtbeachtung des Alo-Gehaltes (3.5%) im P-Sorptionsmodell begründet werden. Die Tongehalte des AhE-, Bfe,al-, Bfe- und des BC-Horizontes mußten auf 0.1% gesetzt werden, damit überhaupt Sorption berechnet wird. Erwartungsgemäß liegen die Modelldaten sehr niedrig. Die Sorptionsdaten, mit Ausnahme des Bfe,al-Horizontes, ebenfalls. Im Bfe,al-Horizont kann die Unterschätzung der Laborergebnisse wie im Bh,fe-Horizont durch den hohen Alo-Gehalt von 5.6%, der in der PTF keine Berücksichtigung findet, bedingt sein.

Abb. 6-8: Gegenüberstellung der gemessenen Phosphatsorption mit den Modellwerten für die Horizonte des Eisen-Humus-Podsols (Mess13 = gemessene P-Sorption bei 13.2 mg P/l Ausgangskonz., Mod13 = modellierte P-Sorption bei dieser Ausgangskonz.)
Die Sorptionsdynamik in Böden unter Laborbedingungen wird durch die TEMKIN-Gleichung beschrieben. Die Parameter dieses Modells werden durch Pedotransferfunktionen abgeleitet. Die Übernahme der PTF und die Implementierung in ein Sorptionsmodell werden durch die Sorptionsdaten von KUHNT (1987) überprüft, da Daten aus Schüttelversuchen mit Phosphat im Untersuchungsgebiet nicht vorliegen. Die Modellvalidierung zeigt, daß die PTF außerhalb ihres Gültigkeitsbereiches eingesetzt werden können. Das Sorptionsverhalten der Bodensubstrate kann auch bei hohen Phosphatausgangskonzentrationen gut geschätzt werden. Problematisch erscheint die hohe Sensibilität des Modells gegenüber niedrigen pH-Werten. Der Einfluß des Aluminiumgehaltes in Böden auf die Phosphatsorption wird nicht berücksichtigt und kann zu Fehleinschätzungen führen. Die Modellierung der Phosphatsorption unter Freilandbedingungen wird durch Koppelung an WASMOD & STOMOD realisiert.
Die Veränderung der Systemumgebung und der Modellanforderung erfordert eine erneute Verifikation, Sensitivitätsanalyse, Kalibrierung und Validierung unter der veränderten Modellumgebung.